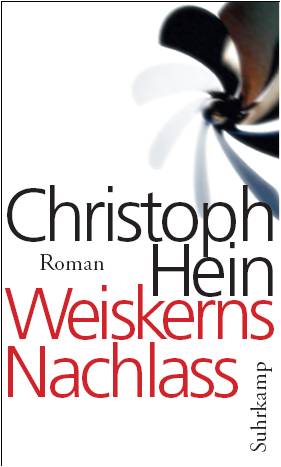Ein Buch, dringend und nötig
24. August 2011 von Thomas Hartung
Christoph Hein war immer unbequem. Man denke an die Novelle „Der fremde Freund“ (1982) und deren gefühlskalte Ärztin Claudia: Seismograph für ein Land, das an Gleichförmigkeit litt, an einer Perspektive des Wartens, das nur noch wenige Erwartungen in sich trug. Und man denke erst recht an seine „Zensur“-Rede auf dem X. Schriftstellerkongress der DDR 1987. Und jetzt also wieder: ein unbequemes Buch. Ein Roman, der schon fast als zeitgeschichtliches Dokument gelten kann.
Die Hauptperson: ein Ost-Germanist an seinem 59. Geburtstag (und ein paar Herbstwochen danach), auf perspektivloser halber Stelle an der Ost-Uni, exotisches Forschungsgebiet natürlich (wer kennt den aus Sachsen gebürtigen Wiener Barockschriftsteller Friedrich Wilhelm Weiskern?); eine Figur also, deren Name „Rüdiger ‚Stolzenburg‘“ eine dreifache Karikatur ist: der Vorname (der sich aus germanisch hroth / hruod „Ruhm, Ehre“ und althochdeutsch ger „Ger, Speer“ zusammensetzt und so viel bedeutet wie ruhmvoller Speerkämpfer) führt den Charakter ad absurdum, und der Nachname verweist darauf, dass er stolz ist auf Werte, die nichts mehr gelten, und darum eine Burg um sich gebaut hat, von deren Turm er die nichtakademische Realität distanziert betrachtet, ohne sie zu verstehen geschweige denn zu durchschauen – vom Dazugehören gleich gar nicht zu reden. Ein Mann, der prompt das Pech magisch anzuziehen, ja sich im freien Fall zu befinden scheint, ein moderner Hiob.
Dass er von seinem Gehalt mehr schlecht als recht am Rande des Existenzminimums siecht, sich mit Nebenjobs über Wasser halten und trotzdem mit dem Finanzamt streiten muss, das es sich offenkundig nicht vorstellen kann, wie ein Mann seines Bildungsniveaus derart bescheiden lebt – geschenkt. Dass seine Tochter nur anruft, wenn sie Geld braucht, und seine Eltern, um ihn mit den „üblichen Klagen“ zu überschütten – geschenkt. Dass er bindungsunwillig bis -unfähig ist und ab und zu neben ungeliebten Freundinnen, die er auf Distanz hält („gewöhnlich flüchtet er sich in eine unverbindlichere, allgemeine Anrede, meine Liebe zum Beispiel, oder Schatz oder Spätzchen, das erspart Ärger“), auch mit Studentinnen ins Bett steigt – ebenfalls geschenkt, selbst wenn dieses charakterliche Gewordensein biographisch vielfach interpretierbar ist. Und dass der Ex-Dramatiker Hein eine Kriminalhandlung mit einbaut, um zwischen den vielen unbequemen Aussagen ein paar Ablenkungen zu schaffen, braucht ebenso nur erwähnt zu werden wie die Einrahmung des Stoffs im ersten und letzten Kapitel mit dem wolkenversperrten, weltabgewandten Blick durch das Fenster eines ausgebuchten Billigfliegers – und dem Eindruck eines stehenden Propellers.
Für mich legt dieser lapidare, tiefpessimistische Roman, dessen unbarmherzige Gesellschaftskritik so allumfassend ist, dass die FAZ schon ein neues Ausloten der Formen realistischen Erzählens in einer Welt des halbvollen Glases konstatiert, seine Schwerpunkte auf die Bildungsmisere dieses Landes. Den ersten, für mich wichtigsten, aus hochschulischer Perspektive. So wundert sich die „Märkische Allgemeine“ über die „gnadenlose Schärfe, mit der Christoph Hein die Zustände im deutschen Universitätsmilieu entlarvt“, über den „Ungestüm, den mentalen und physischen Verschleiß anzuprangern, dem Lehrkräfte momentan hierzulande im akademischen Mittelbau unterliegen“.
Stolzenburg dient „dem Gegenglück, dem Geist“ (G. Benn), und tut sich damit in der illiteraten kapitalistischen Gegenwart schwer. Denn für Geisteswissenschaften ist kein Geld mehr da. Wo Lehre und Forschung, Kunst und Bildung waren, herrscht Marketing: das Diktat von Nachfrage und Gewinn. Man fragt nach den Kosten, nicht mehr nach dem Sinn einer Aktion. Das sticht mitten hinein in die neudeutsche Gegenwart, in eine Gesellschaft, die ihr Gelingen nach marktwirtschaftlichen Kriterien beurteilt. Die mit ihrem Geist arbeiten, werden zwangsläufig zynisch und deprimiert. Da mutet der Einwand der FAZ „Man wundert sich, was er davor gemacht hat. Hätte es nicht einen anderen als den universitären Weg gegeben?“ eher weltfremd an: selbst wer andere Wege ging, bleibt in seiner Herkunft gefangen – zum ersten Durchstarten kam es in der DDR nicht mehr, jedes zweite und weitere dagegen wird der Logik einer materialistisch orientierten Gesellschaft geopfert, die selbst von profilierten Intellektuellen erwartet, dass sie sich über abrechenbare Leistungen definieren. Sinnfragen sind unerwünscht, Nachfragen sowieso. Als Gradmesser gesellschaftlicher Anerkennung gilt allein der finanzielle Erfolg. Das hatte vor wenigen Tagen schon Frank Schirrmacher in der FAZ konstatiert: „Eine Ära bürgerlicher Politik sah die Deklassierung geistiger Arbeit, die schleichende Zerstörung der deutschen Universität, die ökonomische Unterhöhlung der Lehrberufe“ – man kann das fast als journalistische Zugabe zum Roman lesen.
„Zu meinem Helden gehört, dass er bestens ausgebildet ist und schlecht bezahlt wird“, erklärte Hein in einem Interview für den österreichischen Rundfunk. Und bemerkt gallig weiter: „Die Alma Mater ist auf dem Markt gelandet… Ein Mathematikprofessor vor fünfzig Jahren stand in einem Verhältnis von fünf zu seinen Studenten. Jetzt können Sie bei der Zahl der Studenten eine Null anhängen. Bei den Medizinern können Sie zwei Nullen anhängen … Ich kenne Dozenten, die davon ausgehen, dass 80 Prozent der Hausarbeiten zusammenkopiert sind.“
Entsprechend hat Stolzenburg Motivation und Elan aufgebraucht. Im Seminar „taucht kein einziger Gedanke auf, der, wie unausgegoren auch immer, es wert wäre, entfaltet zu werden…“. Die Illusionen sind verraucht, inzwischen glimmt die Routine: „Er riss seine Stunden herunter, er arbeitete mit uralten, vor Jahren erstellten Manuskripten, er lebte von der Wiederholung und scheute sich auch nicht, wie ein Stadttheaterbuffo die erfolgreichsten Stücke seines Repertoires immer wieder anzusetzen und, am Pult stehend, einen unendlich oft durchgekauten Gedanken auf eine Art zu präsentieren, als würde ihm dieser Geistesblitz gerade in jenem Moment einfallen.“
Vielleicht gab es zu Beginn seiner Hochschullaufbahn noch Studenten, die seinen Vorlesungen interessiert folgten, doch die Maßstäbe haben sich geändert, in der Gesellschaft und an der Universität. Waren es in Vorzeiten Bildung und Geist, die den Platz eines Menschen oder auch eines Lehrfachs zumindest mitbestimmten, ist der einzig gültige, verbliebene Maßstab das finanzielle Vermögen. Hollert, einer seiner Studenten, die er in der Mehrzahl für lustlos, verwöhnt, faul und dumm hält, ja als Vertreter der Generation „willig und billig“ als leidenschafts- und ideenlos verachtet, verfügt, da von Beruf Sohn, über viel mehr Geld als er. Und bei Stolzenburg, der ihn hasst, blitzt wenigstens sporadisch die Wahrnehmung sozialer Wirklichkeit auf, wenn er anmerkt: „Es wäre vernünftiger, das Verhältnis umzudrehen, sein Schüler zu werden statt seinen Lehrer zu spielen.“
Aber Hollert muss sein Studium unbedingt erfolgreich abschließen, um die Firma seines Vaters erben zu können. Stolzenburgs „Hilfe“ würde er sich 25.000 Euro kosten lassen. Diesem moralischen Haken, der in seinem Leben bisher ein Garant für Halt war, kann er nicht entkommen. Denn wie immer er sich entscheidet, für das geschrumpfte Sein der letzten Jahre oder für ein kleines Abenteuer mit fremdem Geld, er wird verlieren: Entweder sein Selbstbild oder sich selbst im traurigen Niedergang der Wissenschaften. Das bunte, neue Deutschland hält, so Heins Buch, weniger Alternativen bereit, als viele ihm zu Wendezeiten zugetraut hatten.
Gleichzeitig blühen die auf, die ihr vieles Geld beispielsweise an den Börsen verdienen und mit Werten jonglieren, „von denen Sie nicht wissen, wie sie entstehen, wer sie festlegt und verändert oder manipuliert, was sie in der wirklichen Welt darstellen“. Jener fast sympathisch gezeichnete Steuerberater etwa, der als Studienabbrecher sein Geld in den frühen Morgenstunden mit Börsentransaktionen in Asien verdient und sich wundert, dass ein gebildeter Mensch wie Stolzenburg ein so bescheidenes Salär erhält. Auch Stolzenburg steht früh auf, er bereitet seine Seminare vor, unterrichtet, betreut Abschlussarbeiten, korrigiert Klausuren… und erklärt dem Aktienjongleur ungerührt: „Die Bewegungen der Börsennotierungen zu verfolgen, auf Anzeigetafeln mit Zahlen zu starren, mit Rohstoffen und fiktiven Werten zu spekulieren, das würde mich in Depressionen stürzen.“
Als zweiten Schwerpunkt identifiziere ich für mich die charakterliche Perspektive auf die Bildungsmisere. Eine Perspektive, die sich aus einem bestimmten Maß oder eben Nicht-Maß an Bildung ergibt, oder besser, ihrem (stetig fallenden) Wert, den ihr verschiedene Figuren beimessen. Dass Studienabbrecher Börsenfüchse werden, rhetorisch, historisch und grafisch Begabte einen offenbar europaweiten Fälscherring aufziehen und mit gefälschtem Wissen Geschäfte machen, kann Stolzenburg noch in seinen Kosmos einfügen – zumal er als Kurzzeitverdächtiger zur punktuellen Aufklärung des Fälscherrings wenn auch gezwungenermaßen beiträgt. Jene Gang dreizehnjähriger Mädchen, die Stolzenburg mit einer Schlagkette zu Leibe rücken, überschreitet diesen Kosmos dagegen komplett. Er, der Kulturvolle, Gebildete, der die Halbwüchsigen als Kinder ansieht, deren Gefährlichkeit er bis zuletzt nicht wahrnimmt, reflektiert selbst grün und blau geschlagen sein pädagogisches Bemühen, „gegen die aggressiven Mädchen nicht Gewalt anwenden zu müssen“, und die Ursachen für dieses „Leben mit geballten Fäusten“. Das mag das Klischee der verwahrlosten, gewaltbereiten Jugend bedienen (der Roman nutzt in Maßen noch weitere), aber es spiegelt vor allem Stolzenburgs zwischen Amüsement und Fassungslosigkeit pendelnde Gemütsverfassung, als er spürt, wie Freiheit in neoliberale Grenzenlosigkeit umschlägt. Die Konsequenz wird bereits am Ende des ersten Romandrittels präsentiert und liest sich wie eine Synopse seines Lebens: „Er bleibt liegen und wartet. Wartet, was passiert, unfähig, sich zu wehren, aufzustehen, zu flüchten.“

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Christoph_Hein.jpg&filetimestamp=20070211135603
Welche Überlebensstrategien, Machtstrukturen, Denkweisen und Phantasien ein desillusionierter Mensch entwickelt, um die täglichen Verbitterungen, Erniedrigungen zu ertragen, um Würde und Lebensform zu wahren, das interessiert Hein. Und spiegelt in diesem Einzelschicksal aus dem „geisteswissenschaftlichen Prekariat“ präzise den Zustand der Gesellschaft. Stolzenburg steckt in einer Welt fest, die nur noch den unmittelbaren Gebrauchswert einer Leistung anerkennt. Alles muss zu Geld werden. Oder zu einer „geldwerten“ Leistung. Hein macht vom Besonderen aus das Allgemeine sichtbar, denn die Irritation wirkt flächendeckend: an mehreren Stellen könnte dieser Roman eine Wendung zum Albtraum oder Thriller nehmen – er lässt es. Hein erzählt geheimnislos, gnadenlos, sehr gegenwärtig, sehr schlicht, lakonisch, ja karg.
Ich habe mit Hein anläßlich der „Dresdner Taschenbergespräche“ Ende der 90er ein wunderbares Interview (er las sein „Napoleonspiel“) führen dürfen. Einen Kernsatz vermittle ich meinen Studenten bis heute weiter: „Abends schreibt man mehr, aber man muss morgens auch mehr wegschmeißen. Das etwas unfreundliche Licht der Frühe hilft bei der Konzentration auf das Nötige.“
Er hat ein dringendes, ein nötiges Buch geschrieben. Sehr dringend, und sehr nötig. Ich würde ihm gern danken. Aber ich kann es gerade nicht. Vielleicht bin ich selbst so ein Phantast, so ein Lebensreformer, Irritierter, Besonderer. So einer, der sich dem Nötigen nicht konzentriert widmen mag.
Christoph Hein, Weiskerns Nachlass. Suhrkamp Verlag Frankfurt 2011. 319 Seiten, 24,90.