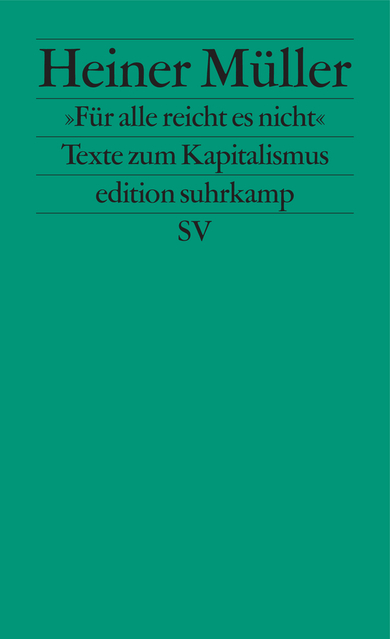„Für alle reicht es nicht“
29. April 2017 von Thomas Hartung
„Im Meer der Überfremdung ist Deutschsein die letzte Illusion von Identität.“ (1992)
Heiner Müller (1929 – 1995) war für mich die Verkörperung des philosophisch-literarischen Dialektikers. Gemaßregelt trotz Erfolgs in dem einen System, stand der unorthodoxeste aller Brecht-Schüler dem anderen nicht minder skeptisch gegenüber. Unvergessen seine kurze Rede am 4. November 1989 auf dem Alex – der Dramatiker hatte einen seiner düsteren Orakel-Auftritte, als er, leicht angetrunken, nach vielen kämpferischen Optimisten an der Reihe war und den Hunderttausenden Sätze zuwarf wie:
„Die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken. Die Daumenschrauben sollen angezogen werden. Die Preise werden steigen und die Löhne kaum. Wenn Subventionen wegfallen, trifft das vor allem uns. Der Staat fordert Leistung. Bald wird er mit Entlassung drohen. Wir sollen die Karre aus dem Dreck ziehen.“
„Ich hatte das ungute Gefühl, dass da ein Theater inszeniert wird, das von der Wirklichkeit schon überholt ist, das Theater der Befreiung von einem Staat, der nicht mehr existiert“, wird Müller später über diesen Tag sagen. Während andere sich auf die neue Freiheit freuten, ahnte er, dass die Zukunft nicht nur nett werden wird. Er war nicht besonders überrascht, dass er ausgepfiffen wurde: „Als mir am Fuß der improvisierten Tribüne eine Welle von Hass entgegenschlug, wusste ich, dass ich an Blaubarts verbotene Tür geklopft hatte, die Tür zu dem Zimmer, in dem er seine Opfer aufbewahrt“, kommentierte er später die wütende Reaktion auf seinen Beitrag zur friedlichen Revolution.
Fünf Tage vor dem Mauerfall zu sagen, dass die Befreiung von der Diktatur und der Planwirtschaft auch Wende- und Modernisierungsverlierer produzieren wird, war ein Stimmungskiller in der Euphorie der Wendetage. Falsch aber war es offenkundig nicht. Müller neigte nicht dazu, die Zustände zu romantisieren, weder in der DDR noch im Westen. „Und jetzt heißt es in den reichen Ländern, mit Blick auf die wachsenden, übervölkerten und näher rückenden Armutszonen: ‚Für alle reicht es nicht.‘ Daraus folgt die Selektion“, formulierte er prompt ein paar Monate vor seinem Tod.
Seine Prognose heraufziehender Verteilungskämpfe wurde im Taumel der Wende ebenso oft belächelt wie zurückgewiesen. Mit dem Ausbrechen barbarisch geführter Terrorkriege und den daraus resultierenden Flüchtlingsströmen ist sie allerdings Realität geworden. Die Fragen, die sich damit stellen, lauten: Reicht es wirklich nicht für alle? Soll es überhaupt für alle reichen? Wie weit klaffen die politischen Gegebenheiten und die Hoffnung auf eine gerechte Welt auseinander? Sind Verteilungsfragen nicht Kraftquelle von linkem wie rechtem „Populismus“? Denn schon 1991 prophezeite Müller:
„Das [Horkheimers Vision der Zukunft als total verwalteter Welt und AldousHuxleys Schöne neueWelt] ist die pessimistische Variante der Hoffnung, dass die Festung Europa auf Dauer gehalten werden kann. All diese Visionen unterschlagen, dass die dritte Welt eine Macht ist; dass die, auf deren Kosten man lebt, dem nicht ewig tatenlos zusehen werden. Dazu bedarf es keiner militärisch-ökonomischen Stärke. Es reicht völlig, wenn sich Millionen Verelendeter in Bewegung setzen.“
Ein Vierteljahrhundert danach könnte es also durchaus an der Zeit sein, Heiner Müllers Texte neu zu lesen, da sie an Relevanz und Aktualität nichts verloren haben. „Zu entdecken sind prophetische Analysen, die Elend und Schrecken des triumphierenden Kapitalismus im Voraus zur Sprache bringen“ verheißt der Suhrkamp-Verlag, der der „Chance“, die Heiner Müller als Dialektiker noch in der völligen „Ratlosigkeit des Denkens“ erkannt hat, einen „Denkraum“ geben will. Der Band mit eben jenem Titel „Für alle reicht es nicht“ legt eine Auswahl bekannter und weniger bekannter Texte Müllers zum Kapitalismus vor.
Die Gliederung orientiert sich an fünf grundlegenden Aspekten der Kritik, die das Gesamtwerk durchziehen: Im Einzelnen geht es um die kapitalismuskritische Analyse der Konfrontation der Blöcke, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, um den Affekt des Ekels angesichts der unmenschlichen Verelendung und des kannibalischen Konsums, die der Kapitalismus erzeugt,um die kapitalistisch instrumentalisierte Sprache, um die nach wie vor virulente Frage der Religion und schließlich um die kontinuierliche Gegenwart des Krieges.
Zu den „Blöcken“ und damit den sozialen Macht – und Kräfteverhältnissen, die alles andere als harmonisch und friedlich sind, war Müller schon 1994 erstaunlich hellsichtig: „Es gab keinen Feind mehr. Wenn das Reich des Bösen weg ist, ist der Teufel plötzlich überall. Die Barbaren sind etwas Diffuses, Jugoslawien, Armenien, Georgien, überall gibt es diese kleinen Barbarenstämme. Es gibt das Problem, wie hält man die davon ab, in die Wohnstube zu kommen, in der man sich einigermaßen eingerichtet hat. Man braucht Mauern. Es dauert immer eine Zeit, bis man merkt, was nötig ist. Man kann nicht sofort wieder eine Mauer bauen. Man weiß nur, und erfährt jede Woche neu: Man braucht sie. Aber man kann sie in der Form nicht wieder bauen. Man muss sich Zeit lassen und andere Architekturformen entwickeln. Es darf nicht mehr so einfach aussehen, aber eigentlich braucht man es schon.“

Heiner Müller. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/20-todestag-von-heiner-mueller-was-haette-er-in-dieser-zeit-geschrieben-13982555.html
Stichwort Ekel: Der Zeitdiagnostiker Müller hat als genuiner Marxist vor allem in den letzten Jahren vor seinem Krebstod als gefragter Interviewpartner dem Kapitalismus unbarmherzig die Leviten gelesen. Die eigentümliche Dialektik seines Denkens begreift man erst mit Blick auf seine lebensgeschichtliche Situation mit der Allgegenwärtigkeit des Krebses: im Körper, im System, in der Zeit. Prompt gilt sein ganzer Hass der Allgegenwärtigkeit des Kapitals und dessen Verwertungsgesetzen. Wer aber sein Vertrauen auf die Rechtsordnung der liberalen Demokratie setzt, kann laut Müller auch nicht frei sein. Die Wirklichkeit: für ihn „das Unmögliche“, was mit Blick auf eine künftige klassenlose Gesellschaft abzuschaffen ist. Umgekehrt enthält sein dichterisches Werk eine lückenlose Abfolge von Gräueln und Bluttaten. Unglück ist das A und das O in der Müller’schen Welt. Von der Trümmerhalde der Geschichte liest er Begebenheiten auf, um die gewaltsame Einwirkung abstrakter Ideen auf die wehrlosen Körper der Menschen nachzuweisen. Fazit: nur wer auf die untergegangenen Hoffnungen der Toten setzt und deren Utopien mit frischer Stimmkraft belebt, besitzt eine einigermaßen begründete Aussicht auf Zukunft.
Zur Sprache: Seine Dichtung – eine der wortgewaltigsten nach 1945 – tendiert oft zur unwandelbaren Fügung. Wie behauene Blöcke ragen seine häufig in Blankvers verfassten Texte aus der Masse der politischen Gebrauchsliteratur hervor. In ihnen hält Müller Zwiesprache: „ICH HAB ZUR NACHT GEGESSEN MIT GESPENSTERN / Jetzt holt Journaille meinen Schatten heim“. Umgekehrt resultiert das deutsche Unglück laut Müller aus der Unfähigkeit, eine Revolution nach französischem Vorbild zu entfesseln. In seinen Stücken und Gedichten beklagt er die Versteinerung der Verhältnisse, an der auch der Epochenwechsel von 1990 nichts geändert habe. Die „in Rätseln redende Sphinx mit der Davidoff-Zigarre“, wie er kürzlich tituliert wurde, setzte gegen den Kapitalismus, die Bestie „mit der Blutbahn der Banken“, zwar auf die Unduldsamkeit der Unterdrückten – und hatte dennoch ein ambivalentes Verhältnis zu ihnen. Dirk Baecker brachte das 2017 auf den Punkt:
„Wir haben Revolutionen, die sich damit überraschen, dass sie in neuem Gewand Verhältnisse bestärken, die sie überwinden wollten. Und wir haben Protestbewegungen, die sich in der Illusion wiegen, selber nicht den Bedingungen zu unterliegen, gegen die sie protestieren.“
Für den desillusionierten Müller forderte die Bevölkerung ab 1989 die „Realität der Phrase“ ein, da die „Diskrepanz zwischen der Phrase und der Realität“ zu groß wurde. Und weiter: „Der versäumte Angriff auf die Intershops mündete in den Kotau vor der Ware“, komplettiert durch den jahrelangen „Versuch, die Kolonisierten durch die Suggestion einer Kollektivschuld niederzuhalten. Die Narben schreien nach Wunden, das unterdrückte Gewaltpotential bricht sich Bahn im Angriff auf die Schwächeren, Asylanten und Ausländer; keinem Immobilienhai, gleich welcher Nation, wird ein Haar gekrümmt.“ Und bereits ein Jahr später postulierte er
„Das Gute will selektieren, also Minderheiten produzieren. … Es geht um Vereinzelung und nicht um Solidarisierung. Die Tendenz des Kapitalismus ist die Vereinheitlichung, die sich auch auf der Oberfläche der Technisierung abzeichnet und zur Nivellierung führt. Es ist der allgemeine Grundirrtum, dass der Kapitalismus den Individualismus fördert. Das Gegenteil ist der Fall. Der Kommunismus vereinzelt, der Kapitalismus uniformiert.“

Grab von Heiner Müller auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=612946
Religion und Krieg: In Anlehnung an Ronald Pohl (2017) kann man Müllers Haltung mit dem Satz „Solange es Herren und Sklaven gibt, sind wir aus unserem Auftrag nicht entlassen“ auf den Punkt bringen. Freiheit ohne Gleichheit auf der einen Seite, Gleichheit auf Kosten der Freiheit auf der anderen, erkannte er schon 1987. Auch hierzu trefflich Dirk Baecker: „Denn frei, gleich und brüderlich ist es nirgendwo und kann es nirgendwo sein. Die Formel versorgt sich laufend neu mit Anlässen, sie nach wie vor für berechtigt zu halten. Ihrem Blick auf die Wirklichkeit hält keine Wirklichkeit stand.“
Frappierend dabei sind die nach heutigem Verständnis „rechtsextremen“ Ansätze, die Müller bspw. zur Jugend 1992 so formulierte: „Nach der Zerstörung einer Infrastruktur, die wesentlich auf ihre Beruhigung ausgerichtet war, übergangslos in die Freiheit des Marktes entlassen, der sie mehrheitlich ausspuckt, weil er nur an Gegenwart und nicht an Zukunft interessiert sein kann, ist sie jetzt auf die Wildbahn verwiesen.“ Die „Randalierer“ von Rostock und anderen Orten sind für ihn prompt
„die Sturmabteilung der Demokratie, die radikalen Verteidiger der Festung Europa, gerade weil ihnen auf kurze oder lange Sicht nur der Dienstboteneingang offensteht. … Auf der Tagesordnung steht der Krieg um Schwimmwesten und Plätze in den Rettungsbooten, von denen niemand weiß, wo sie noch landen können, außer an kannibalischen Küsten. Mit der Frage, wie man diese Lage seinem Kind erklärt, ist jeder allein.“
Was bleibt? Es wird nie ganz reichen für alle, ganz gleich, wie viel Überfluss vorhanden ist.Das Lebensprinzip des Kapitalismus ist gerade nicht die Befriedigung der sogenannten Bedürfnisse. Es ist ihre auf Dauer gestellte Nichtbefriedigung, die allein die Dynamik der fortgesetzten Wertschöpfung gewährleisten soll. Müllers lakonische Wendungen formulieren keine frohe Botschaft, widersprechen sie doch dem Optimismus eines politisch-ökonomischen Systems, das sich selbst als emanzipatorische Fortschrittsdynamik, den Garanten individueller Freiheit, des friedlichen Tauschhandels und des allgemeinen Wohlstands beschreibt. „Aus der Geschichte lernen heißt das Nichts lernen“ wäre eine Option. Eine andere:
Politik ist das Machbare Ein Männertraum
Aus dem kein Kind schreit In allen Sprachen
Heißt die Zukunft Tod
Und eine dritte, die ich gern entkräften würde: „Es gibt keinen Dialog zwischen Kunst und Politik. Das ist ein Irrsinn, bei dem es nur zu wechselseitigen Beschädigungen kommen kann.“
Herausgegeben und (schlecht) editiert wurde der Band von Helen Müller und Clemens Pornschlegel, Literaturwissenschaftler am Institut für deutsche Philologie der LMU München: manche Texte doppeln sich unkommentiert (was die Lesart „Funktionalisierung“ nach sich zieht), die einleitenden Kapita lesen sich oft wie mit dem Holzhammer gezimmert, auf dass der Leser ja unbedingt die Kapitalismuskritik erkennen möge. Betreutes Lesen mag ich aber ebensowenig wie betreutes Denken.
Heiner Müller: „Für alle reicht es nicht.“ Texte zum Kapitalismus. Herausgegeben von Helen Müller, Clemens Pornschlegel und Brigitte Maria Mayer. Edition Suhrkamp 2017. 390 Seiten. 16,50 Euro.