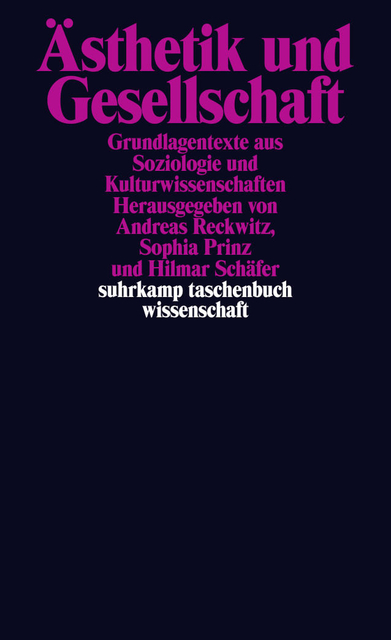Wenn Selektion mit Repräsentation verwechselt wird
14. Juni 2018 von Thomas Hartung
In einem von Rankings und Quoten befeuerten „kulturellen Kapitalismus“ habe die Gesellschaft ihre Bindungskraft verloren – im Gegenteil gehe es jedem Individuum um die narzisstische Anhäufung von – überdies versatzstückhaftem – „Singularitätskapital“. Gewandelt zu einer globalisierten und digitalisierten „Superstar-Ökonomie“, die ihr Geld mit der Bewirtschaftung von Images und Narrativen macht, gehört in diesem Kapitalismus zu den Verlierern, wer oder was nicht als etwas Besonderes wahrgenommen wird. Im gnadenlosen Profilierungswettbewerb auf Märkten, die sich also weniger nach Leistungs- denn nach Attraktivitätskriterien definieren, leben die Gewinner, die eine hochqualifizierte, jedoch nicht klassisch vermögende neue Mittelklasse bilden, das eigene Leben nicht mehr, sondern legen aus Statusgründen mehr Wert darauf, ihr Leben zu „kuratieren“.
Die Märkte, Marktakteure und Marktmechanismen eines so entworfenen zeitgenössischen Vergesellschaftungssystems zu beschreiben ist das Anliegen von Andreas Reckwitz‘ Pamphlet „Die Gesellschaft der Singularitäten“. Dabei ist „Pamphlet“ bewusst gewählt, exerziert das Buch doch beispielhaft, was passiert, wenn ein Text auf einer falschen, aber politisch korrekt ausbeutbaren Annahme gründet, die der Autor für wahr befindet und selbst bei deren Mehrfachversagen nicht revidiert, sondern blindlings zu Ende schreibt: hier in die Falschheit eines dekretierten Radikal-Individualismus hinein, der die psychische Gesundheit des Individuums unterminiert und damit letztendlich dessen Da-Sein als Mensch-Sein negiert.
Diese falsche Annahme ist die Unterstellung, dass seit ca. den 70er Jahren das quantitative Selektionsprinzip medialer Informationspräsentation zum qualitativen Existenzprinzip sozialer Informationsrepräsentation mutiert sei. Das Selektionsprinzip brachte ein Lokalredakteur der amerikanischen „Sun“, John B. Bogart, schon 1880 so auf den Punkt: „When a dog bites a man, that’s not news, but when a man bites a dog, that’s news.“ Oder, ebenfalls in Bogarts Worten: „News is what’s different“. Das Existenzprinzip wiederum formuliert Reckwitz bereits im ersten Satz seines Buchs: „Wohin wir schauen in der Gesellschaft der Gegenwart: Was immer mehr erwartet wird, ist nicht das Allgemeine, sondern das Besondere.“ Ist die Realität zum Massenmedium verkommen, sind wir alle zu (schlechten) Journalisten, im BILD-Sprech „Leserreportern“ degeneriert?
Es scheint in Reckwitz‘ Logik formal zu passen, diesen Mutationsprozess zunächst simpel als verabsolutierte Medialisierung zu begreifen: gerade Massenmedien transportieren inzwischen weniger Informationen denn Affekte. Das Buch offenbart da auch (ungewollt?) kommunikationswissenschaftliche Gedankengänge, zumal man mit Bezug auf Novalis‘ Theorie des „Prozeß der Geschichte“, den jener gleichsam als Verbrennungsprozess interpretiert, auch elegant das Burn-out-Potential seines „Aktivismus-Diktats“ und der damit einhergehenden „Verzichtaversion“ mit seinen vielen Krisensymptomen (Depression als neue Volkskrankheit, Verlust von Gerechtigkeits- und anderen Maßstäben, Orientierungslosigkeit, Überforderung, ja Verabschiedung aus dem anstrengenden Dauerwettbewerb…) erklärt hätte, das der Autor seitenlang ausbreitet und dabei eine interessante psychologische These entwirft. Denn während gemeinhin gilt, dass eine Enttäuschung durch ein nicht erfülltes Erdachtes zur Depression führt, postuliert Reckwitz spezifischer ein „Enttäuschungsrisiko, wenn man den hohen Anforderungen an sich selbst nicht genügt.“
Allerdings nimmt Reckwitz keine der gängigen Prozessdifferenzierungen vor (bspw. nach kausalen, deterministischen und zufälligen, stochastischen) noch erklärt er die Instanz des „was“, die das Besondere erwartet. Dieses Weglassen alles Essentiellen, das die Gedankengänge und damit auch die Richtung des Textes beeinflussen könnte, ist ein leider immer wiederkehrender Aspekt des Buchs, das sich darin gefällt, die eine Oberflächlichkeit mit der anderen zu ersetzen: wir treffen viele außensichtige Schilderungen, die fast krampfhaft innensichtige Reflexionen zu vermeiden trachten.
Natürlich kommen dem Bewanderten sofort die dialektischen Gesetze in den Kopf, insbesondere das vom Umschlagen von Quantitäten in eine neue Qualität. Dass aber viele „Besonderheiten“ zu einem neuen Speziellen aufsteigen, hatte Engels damit nicht gemeint. Mit andern Worten: Reckwitz hört immer dann auf zu schreiben, wenn es wehtun könnte. „Insgesamt herrscht der Eindruck vor: Reckwitz bleibt erstaunlich gelassen angesichts seiner Diagnosen“, findet auch Andreas Richartz auf dem artblogcologne.
Ein Beispiel. Eine „digitale Bewirtschaftung“ der Gesellschaft konstatierend, fragt der Autor, was und wie im Internet bewertet würde, welche Bücher, Filme, Musikstücke als besonders und welche als bloße Massenware gälten. Da tobten Valorisierungs- und also Bewertungskonflikte, bei denen die Bedeutung der Gefühle nicht zu unterschätzen sei: Das Besondere zeichne sich dadurch aus, dass es uns anziehe und berühre. In diesem Sinne könne man von einem „affective turn“, einem starken Bedeutungsgewinn der Affekte in der Spätmoderne sprechen. Zu verstehen sei der auch als Reaktion auf einen Affektmangel in der Massengesellschaft der klassischen Moderne. Ermöglicht worden sei dieser Strukturwandel hin zur Gesellschaft der Singularitäten vor allem durch eine starke Kulturalisierung und Globalisierung der Ökonomie und einen Innovationsschub bei der digitalen Technologie.
All das ist zunächst einleuchtend und folgerichtig dargestellt. Entscheidend ist aber nicht dass, sondern wie und warum Bücher, Filme, Musikstücke… so positiv oder so negativ bewertet werden und von wem (Stichwort Fake-Accounts). Wer nur eine „Wertzuweisung“ konstatiert, ohne Werte, Wertende und Wertmaßstäbe in den Blick zu nehmen, kann notgedrungen nicht zu Tiefenbefunden gelangen. Man stelle sich vor, dass man bei einer halbstündigen Fahrt durch eine vormittägliche, studentisch geprägte Großstadt 20 Ampelkreuzungen passiert, und bei 15 davon erlebt man junge männliche Radfahrer, die rote Ampeln missachten. Am Nachmittag darauf sind es 3 an 13 Kreuzungen. Und zwei Tage später mittags wieder 7 an 16, und so geht das vielleicht ein paar Wochen fort. Natürlich kann man dann ein verkehrspsychologisches Buch über die Aggressivität junger männlicher Großstadt-Radler schreiben und darin behaupten, dass heute als normaler Verkehrsteilnehmer gilt, wer Rot für das neue Grün hält. Aber diese Behauptung ändert halt nichts an der Bedeutung der Farben oder setzt gar die StVO außer Kraft. Genau dieser Ansatz aber scheint der „Gesellschaft der Singularitäten“ zugrunde zu liegen. „In seiner Theorie der Spätmoderne verknüpft Reckwitz so ziemlich alle ärgerlichen und verwirrenden Auswüchse der Gegenwart zu einem logischen System“, tadelt Meredith Haaf in der SüZ. Mir fällt kein Buch ein, während und nach dessen Lektüre ich in den letzten Jahren so ratlos, verärgert, teilweise auch wütend war und dem Autor gedanklich mehrfach „Kehr um“ zugerufen habe.
Singularität als logischer Endpunkt der Standardisierung
„Was heute als exzeptionell gilt, kann morgen schon entwertet und als konformistisch oder gewöhnlich eingestuft werden“, lautet ein eher selbstverständlicher Befund in der Einleitung, dem sich bereits auf Seite 11 Reckwitz’ leitende These anschließt:
„In der Spätmoderne findet ein gesellschaftlicher Strukturwandel statt, der darin besteht, dass die soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft verliert an die soziale Logik des Besonderen. Dieses Besondere, das Einzigartige, also das, was als nicht austauschbar und nichtvergleichbar erscheint, will ich mit dem Begriff der Singularität umschreiben.“
In der Folge überträgt Reckwitz Phänomene singularistischer Lebensführung auf Lebensstile, Klassen sowie Subjekt- und Politikformen. Die Themenkreise, die jeweils einzelnen Kapiteln entsprechen, scheinen zunächst keiner logischen Selektion oder Reihung zu folgen: soziale Moderne, postindustrielle Ökonomie, singularisierte Arbeitswelt, digitalisierte Kulturmaschine, singularistische Lebensführung und „differenzieller Liberalismus“ als Ausdruck des neuen „Politischen“.
Der Autor erläutert zunächst das Entstehen und die Ursachen der von ihm so bezeichneten Singularitäten und stellt die Inhalte der einzelnen Kapitel vor. Auch im weiteren Verlauf des Buches werden den neuen Abschnitten kurze Zusammenfassungen des Vorhergesagten voran- sowie wichtige Kennwörter und Formulierungen kursiv dargestellt. Den formalen Leseerleichterungen stehen allerdings manche Wortungetüme („Authentizitätsperformanz“, S. 137, „apertistisch-differenzieller Liberalismus“, S. 373; oder „vernakuläre Kulturalisierung“, S. 385), ja ganze Schwurbelsätze gegenüber: „Kultur im starken Sinne hat in ihrer Valorisierungs- und Affizierungsstruktur immer die Form eines Nichtrationalen beziehungsweise eines Mehr-als-Rationalen jenseits der produktiven oder intersubjektiven Nützlichkeit.“ Nun ja.
„Prozesse der Singularisierung, Valorisierung und Kulturalisieriung“ würden in der Spätmoderne „leitend und strukturbildend“: Sie lösen eine „Logik des Allgemeinen“ ab, die noch für die alte, industrielle Moderne kennzeichnend war. Fließbandfertigung, Massenkonsum und Sozialstaat, so Reckwitz, hemmten und eliminierten in der industriellen Moderne das Außergewöhnliche zugunsten des Funktionellen, begünstigten das Kollektive zulasten des Individuellen – es herrsche der Geist einer normierten Normalität, in der „außengeleitete Charaktere“, „sozial angepasste Persönlichkeiten“ (Riesman) ein regelhaftes Leben führten und an ihrer „Einpassung“ in die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ (Helmut Schelsky) arbeiteten. Das kann man so sehen.
Die Orientierung am Besonderen könne allerdings für die Einzelnen auch zum Zwang werden. Durch die Abwertung des Mittelmäßigen und Konformen sei ein großer Profilierungsdruck entstanden, der nicht nur alle Lebensbereiche erfassen, sondern auch die Schere zwischen erfolgreichen und erfolglosen Menschen immer größer werden lassen könne. Ein Grund dafür sei, dass erbrachte Leistungen heute Erfolg nicht mehr garantierten. Auch das ist zunächst nicht falsch.
Für Reckwitz ist der Wandel vom Allgemeinen zum Besonderen, vom „Standardisierten“ zum „Einzigartigen“ der Kulturalisierung des Sozialen aber die einzige Ursache, die zur Entstehung der von ihm bezeichneten Singularitäten von Individuen, Dingen und Ereignissen führt. Diese Monokausalität negiert eine Vielzahl historischer Entwicklungen, die der Autor mit Ausnahme der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (warum gerade der?) so gut wie nicht anspricht: das Verschwinden von Adel und Großbürgertum als richtungsweisender, kulturell-normativer Kraft; der Siegeszug der Populärkultur, die sich mit Beginn der fünfziger Jahre sintflutartig ausbreitete; die Nachkriegsgeneration, die Entbehrungen nur vom Hörensagen kannte und für die Werte wie Pflichterfüllung und Aufopferungsbereitschaft keine Bedeutung mehr hatten; ein daraus resultierendes Hedonistentum, das einen Mangel an Lebensnotwendigem nicht kennt, da alles im Überfluss vorhanden war und ist – all das findet auf den über 400 Seiten nicht statt, leider nicht statt.
Denn wir haben es nicht nur mit einer Welt zu tun, in der zum Zwecke der Optimierung, Berechenbarkeit und Effizienzsteigerung normiert, typisiert, standardisiert und generalisiert wurde. Nein, systemische Abstraktion und Generalisierung ist zunächst das Grundprinzip von Wissenschaft. Das wiederum wirft sofort die Frage auf, ob eine Gesellschaft wünschenswert ist, die – überdies künstlich – erzeugte individuelle Gefühle dem objektivierten, wissenschaftlichen Verstand unterordnet, ja die eine „Klickökonomie der Wahrnehmung“ einer „Relevanzökonomie der Verarbeitung“ vorzieht. Diese Frage, wie viele andere auch, stellt Reckwitz gar nicht geschweige beantwortet er sie.
Generalisierung ist aber auch ein kognitiver Wahrnehmungsmodus: erworbene Erfahrungen geben der Informationsaufnahme und –verarbeitung eine Richtung vor, um diese Informationen ins System einzuordnen und handhabbar zu machen, d.h. adäquat zu handeln. Zu einer Systemänderung kommt es erst, wenn zu viele neue Informationen mit der alten Regel nicht mehr handelbar sind und eine neue aufgestellt werden muss. Jedes Curriculum verallgemeinert Bildungsfähigkeiten, jede Krankenkasse Erkrankungen, jeder Versicherer Versicherungsfälle, das ist ein völlig normaler Vorgang – der in Reckwitz‘ Kosmos aber denormalisiert, oder neudeutsch: dekonstruiert wird.
Der Autor spannt in der Einleitung auch ein kompliziertes Koordinatensystem auf, das den sechs Kapiteln eine nachvollziehbare Ordnung geben soll. So könnten zunächst fünf Einheiten des Sozialen zum Gegenstand von Prozessen der Singularisierung werden: Objekt und Dinge, menschliche Subjekte, Kollektive, Räumlichkeiten und Zeitlichkeiten – man kann durchaus von kompositorischer Singularität sprechen. Diese Prozesse ließen sich in – auch mehrfach auftretende – Praktiken der Beobachtung, der Bewertung, der Hervorbringung und der Aneignung differenzieren, die die Praxis des bloßen „Lebensstandards“ als Ziel in der alten Industriegesellschaft deutlich übersteige.
Die Einheiten des Sozialen wiederum ließen sich mit fünf – nicht trennscharfen – Qualitäten unterscheiden und qualifizieren: der ästhetischen, narrativ-hermeneutischen, ethischen, gestalterischen und ludischen (spielerischen). In jedem Kapitel werden dann pro Einheit, Praxis und Qualität die Phänomene aufgegriffen, die der Autor jeweils für relevant hält. Diese wiederholen sich nicht nur oft, es liegt auch in der Logik von Reckwitz‘ Kosmos, dass er alles mit allem verbindet, beschreibt, im Raum stehen lässt, 2 oder 20 Seiten später wieder aufgreift… daher ist die Besprechung nach Kapiteln auch nur eine hilfsweise, die die Stofffülle bändigen und zu viel Redundanz verhindern mag.
1 Der Themenkreis „soziale Moderne“
Die Industrie-Moderne war nach Reckwitz eine „Standardisierungsmaschine“, die Lebensläufe einander anglich – heute sei der Durchschnittsangestellte mit Durchschnittsfamilie eine „konformistisch erscheinende Negativfolie“. Dass ausgerechnet dieses traditionelle, fast schon als überkommen geltende Familienmodell aus wissenschaftlicher Sicht das Glück der Familie zu mehren scheint, wie die ZEIT jetzt, wissenschaftlich bestätigt, zugeben musste, ist da sicher eine lässliche Sünde. Der kulturelle Kapitalismus hingegen verlange von seinen Mitspielern, dass sich jeder als Besonderheit, als Singularität, als Individuum mit Alleinstellungsmerkmal vermarkte – man könnte auch „seriell eingeforderte Einzigartigkeit“ sagen, der Autor nennt das „Singularitätsprestige“. Allerdings: da nur dann in der Welt etwas gelte, wenn es interessant und wertvoll ist, herrsche in der von den sozialen Medien unterfütterten Überflussgesellschaft nicht mehr ein Mangel an Gütern und Informationen, sondern an Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
Der fundamentale Strukturwandel unserer Zeit liege also in der Verschiebung der sozialen Logik: Das Singuläre – das Einzelne, Besondere, Hyperindividuelle – dominiere das Allgemeine. Während also die Moderne mit all ihrer Normativität, ihren Standardisierungen von Abläufen, ihren Ideal-Typen, ihrer Formatierung und ihren sozialen Begrenzungsmechanismen eine einzige „Generalisierungsmaschine“ war (Reckwitz‘ Hang zu Maschinenmetaphorik fällt durchaus auf), würden seit etwa den Achtzigerjahren die Global Player von Wirtschaft und Kultur daran arbeiten, Güter, Leistungen und Subjekte in den gegenteiligen Zustand zu bringen. Dazu könnte man fast „ökonomischer Machiavellismus“ sagen. Reckwitz spricht von der Kulturalisierung der Ungleichheit.
Insofern fände in unseren zeitgenössischen Arbeits-, Konsum- und Kommunikationsstrukturen nur gut Platz, wer ein Einzelner sein kann – mit bestmöglich ausgebildeten Kapazitäten und Kompetenzen. Gesellschaft ist in dieser Logik nicht mehr vorrangig dazu da, um Teil von ihr zu sein, sondern um vor ihr zu glänzen: man könnte das Zeitalter des Hyper-Individuums ausrufen. Reckwitz versteigt sich zu der These, dass wir das nicht der Selbstoptimierung wegen machen, sondern weil wir es auch so wollten. Wer uns umgibt, tut das nicht in erster Linie als potentieller Partner, Verbündeter oder Kontrahent, es gehe gar nicht so sehr darum, sich in ein Verhältnis zum anderen zu setzen. Wer uns umgibt, dient eher dem eigenen Wertabgleich. Da kann man auch gleich das Ende jeder Beziehung ausrufen bzw., um in Reckwitz‘ Diktion zu bleiben, von Entzweiungsmaschine reden. Ein fürchterliches Szenario: Schon Fortpflanzung ist auf eine (Zweier)Gemeinschaft gegründet, bei einer Familie sind es mindestens drei, die ein Verhältnis, auch ein Wertverhältnis, eingehen und leben, nicht aber sich in dasselbe „setzen“. Ein neues Entfremdungsbuch also? Ja, aber noch weit mehr.
„Das spätmoderne Subjekt“, schreibt Reckwitz, strebe „für sich und sein Leben nach Befriedigung im Besonderen“. Wertschätzung ist dann eine Erfahrung, die – in beruflichen, politischen, aber auch privaten Kontexten – aber immer seltener etwas mit Zugehörigkeitsgefühlen oder Sicherheiten zu tun hat, sondern immer häufiger mit eher flüchtigen Zuwendungen von Aufmerksamkeit. Auf dem Arbeitsmarkt ist das vor allem für diejenigen spürbar, die mit befristeten Verträgen oder als Sub-Unternehmer oder freie Mitarbeiter beschäftigt sind.
Denn: „Als singulär können dabei sämtliche Eigenschaften und Aktivitäten des Subjekts erscheinen: seine Handlungen und kulturellen Produkte, seine Charakterzüge, sein Aussehen und andere körperliche Eigenschaften, auch seine Biografie. Sie müssen jedoch in irgendeiner Weise performt werden, um nicht bloße Idiosynkrasie zu sein, sondern als Einzigartigkeit anerkannt zu werden” (S. 80). Die entstandene neue Mittelklasse sei stark geprägt von einem doppelgesichtigen Liberalismus. Zum einen habe der Wirtschaftsliberalismus zu einer Öffnung und Deregulierung der Märkte geführt. Zum anderen habe die Neue Mittelklasse sich aber auch kulturell und politisch geöffnet, einem linksliberal geprägten Kulturkosmopolitismus zugewandt. Im Gegenzug werde das Provinzielle stark abgewertet.
Auf diese doppelte Öffnung gebe es nun verstärkte Gegentendenzen. Reckwitz sieht hier ein Erstarken des „Kulturessenzialismus“. Rechtspopulistische, nationalistische, religiös-fundamentalistische, teilweise auch ethnische Gruppen würden kollektive Identitäten wieder stark machen. Sie setzten auf das Eigene, das Heimische und eine in sich homogene wie abgeschlossene Gemeinschaft. Diese Reaktionen würden vor allem getragen von der Neuen Unterklasse und der alten Mittelschicht.
Das liest sich wie eine soziologische Erklärung der Heimatbesinnung: den Phänomenen der Singularisierung wollen die singularisierungsunwilligen Neu- und Alt-Armen also eine erneute soziale, aber auch räumliche „Kollektivierung“ entgegensetzen. Indirekt bestätigt das Reckwitz durch seine Feststellung, dass sich auch andere „Kollektive“ formierten, die unter den Begriff der „Neogemeinschaften“ gebracht werden könnten. Was postmigrantische, regionale, aber auch nationalistische Kollektive verbinde, sei die starke Profilierung einer eigenen, besonderen Identität. Deutschland ist aber keine Neogemeinschaft!
Teile der Gesellschaft aber erwarten und verlangen Regulierung. Zum einen wirtschaftspolitisch, das gilt als „links“ und heißt „Obergrenze für Managergehälter“. Zum anderen gesellschaftspolitisch, das gilt als „rechts“ und heißt „Obergrenze für Einwanderung“. Nun zeigen aber die populistischen Wählerwanderungen in Frankreich und Italien, aber erst recht die von der Linkspartei oder der SPD zur AfD, dass diese Regulierungsbedürfnisse nicht klar in gut/links und böse/rechts zu trennen sind, sondern sich überschneiden: Reckwitz spricht von „Kommunitariern“. Es geht nicht nur um soziales Abgehängtsein, sondern auch um das Gefühl kultureller Herabsetzung im Sinne von Verächtlichmachung alles Tradierten.
2 Der Themenkreis „postindustrielle Ökonomie“
Dieses Kapitel kommt wie auch das nächste ohne die Fundierung bedeutsamer wirtschaftspolitischer Machtakte wie zum Beispiel die Deregulierung des Finanzsektors aus, wirkt teilweise harmlos und bleibt insgesamt eher bei einer Analyse des Verhaltens von Konsumenten und Arbeitnehmern. Reckwitz betont zunächst, dass „Singularisierung“ unter ökonomischer Perspektive ein funktionales Standardprodukt in ein Einzigartigkeitsgut verwandelt, indem sie dieses ästhetisch, affektiv und narrativ auflädt.

Andreas Reckwitz. Quelle: http://www.thomasius-club.de/wp-content/gallery/2016-05-andreas-reckwitz/Reckwitz_2.jpg
Er konstatiert einen systemischen Wandel der Ökonomie, einen Wandel von der Industriewirtschaft hin zu einem kulturellen Kapitalismus, der immer mehr zu einem Kapitalismus der Zeichen und Erlebnisse sowie der kreativen Objekte wird. Da dieser Wandel neue Konsumentenschichten und Absatzmärkte erschließe, habe die Ökonomie selbst ein Interesse an ihm. Gegründet sei er zum einen auf der medientechnologischen Entwicklung der Digitalisierung: Das Internet sei eine Plattform zur Profilierung von Singularitäten, denn nur diese zögen Aufmerksamkeit auf sich. Gegründet sei er zum anderen auf der Trägergruppe der neuen Mittelklasse als Produkt von Bildungsexpansion und postmaterialistischem Wertewandel, die die Singularisierung als zentralen Antrieb ihres Lebensstils begreife. Das deutet zwei Problemkreise an: die mediale Aufmerksamkeitsschlacht und den personalen Wertewandel.
„Noch bevor sich die Frage der Kommerzialisierung und des finanziellen Profits stellt“, bringt Reckwitz die Funktionsweise des „Kulturkapitalismus“ auf den Punkt, „wird die Einzigartigkeit selbst kapitalisierbar, das heißt, sie kann zum akkumulierbaren Kapital werden, das Erträge ganz ohne zusätzliche Arbeit abwirft.“ Man könnte das auch „soziale Fabrikation des Einzigartigen“ nennen. Denn Güter finden ihre Bewertung eher über die Art, wie sie sich präsentieren, weniger über die Frage ihrer tatsächlichen Nützlichkeit. Im alten Industriekapitalismus gab es Standardmärkte und Güter, die leicht über den Preis oder den Nutzen vergleichbar waren. Der kulturelle Kapitalismus lebt dagegen von Gütern, die den Anspruch haben, einzigartig zu sein.
Dieser Anspruch hänge jedoch von teilweise unberechenbaren Formen des Erlebens und Bewertens ab. Das beginnt bei den traditionsreichen Märkten für kulturelle Güter wie Kunstwerke, Literatur oder Musik: Hier herrscht, was Ökonomen als „the winner takes it all“-Märkte bezeichnen. Es gibt also Güter, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und als einzigartig valorisiert werden – wie bekannte große Musikstücke oder vielgelesene Romane. Und es gibt andere, denen die „Vermarktlichung“ ihrer Güter nicht gelingt, was dann eine Polarisierung nach sich zieht.
Wenn das Publikum als Zertifizierungsinstanz auftritt, verhält es sich widersprüchlich und unberechenbar. Die Unberechenbarkeit der Anerkennung, auf der der Erfolg von Singularitätsgütern als ungewisse Güter auf Nobody-knows-Märkten beruht, bedingt eine „Überraschungsökonomie“, da niemand vorhersagen kann, welcher neue Roman zum Bestseller oder welches Computerspiel zum Hit des Weihnachtsgeschäfts wird. Herausragende kreative Leistungen werden nicht immer erkannt und mit Wert bemessen, oft führen sie nicht zum Erfolg. Wenn Kreativität gesellschaftliche Anerkennung ermöglicht, kann ein Nachlassen der Fähigkeit die soziale Herabstufung oder den Ausschluss mit sich bringen.
Fast ist man an das Bonmot des legendären Bundestrainers Sepp Herberger erinnert: „Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht“. Nicht mehr der Kampf um knappe Güter ist für die Spätmoderne konstitutiv, sondern der Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums und dessen Mobilisierung. Aufmerksamkeit muss gelenkt, intensiviert und gefiltert werden, ein höchst dynamischer Prozess. In diesem Sinne ist die Singularitätskultur im Unterschied zum auf Standardisierung und Marktförmigkeit ausgerichteten Spätkapitalismus eine höchst riskante Kultur.
So hat Klaus-Dieter Felsmann im Blättchen richtig erkannt, dass einen höheren Status erlangt, wer kulturelle Singularitätsgüter verfertigt, als jene, die sich um das Profane, Nichtsinguläre kümmern. Divergierende Lebensstile führen dann aber auch zur Polarisierung sozialer Räume. Die Orientierung am Wertvollen versuche die neue Mittelklasse in alle Bereiche ihres Alltags, weit über die klassische Kunst hinaus, einzubauen. Aber diese Wertzuschreibung ist mitunter hochgradig umstritten. Was ist denn wertvoll? Vegane Ernährung, eine Netflix-Serie, ein Reiseziel? Die Dynamik der Valorisierung des Wertvollen und Singulären prägt das soziale Leben aber in großen Bereichen, wovon bspw. Bewertungsportale im Internet künden. Dass man Bewertungen aber auch kaufen kann, lässt Reckwitz ebenso außer acht auch wie Andersons Theorie vom „long tail“, wonach Anbieter virtualisierbarer Produkte den Großteil ihrer Umsätze mit Nischenprodukten machen.
Wenn also Einzigartiges von Aufmerksamkeit und Bewertungsdiskursen abhängt, sind das soziale Prozesse, die ein bestimmtes Zufallselement aufweisen, das zu ergründen ebenso spannend wie nötig ist. Worauf richtet sich die Aufmerksamkeit, wem gelingt ihr Signalement, wie wird valorisiert? Mit industriegesellschaftlichen Kriterien der Leistungsgerechtigkeit sind diese Prozesse kaum mehr vereinbar. Das gilt für viele Bereiche der Ökonomie, ja der Gesellschaft insgesamt. Allerdings vermeidet Reckwitz sowohl die Frage, ob „Leistungsgerechtigkeit“ ein natürlich empfundener oder ein imaginierter, erdachter Zustand ist, als auch die Ergründung an sich.
Die Folgen allerdings thematisiert er sehr wohl: da im Unterschied zur organisierten Moderne, die Standardprodukte und (wachsenden) Lebensstandard zum Ziel hatte, die Ökonomie der Spätmoderne auf Singularität und Lebensqualität ausgerichtet sei, ist sie nicht leistungs-, sondern erfolgsorientiert und bringt für viele die frustrierende Erfahrung mit sich, dass sich Arbeitseinsatz und -erfolg entkoppelt haben. Es reiche nun nicht mehr, sein Arbeitspensum zu erfüllen – der „Selbstverwirklichungsimperativ“ verpflichte zu einem interessanten und erfüllenden Beruf, andernfalls man als Langeweiler aus den Aufmerksamkeitsmärkten aussortiert wird. Kein Wunder also, dass die Erschöpfungsdepression zum „emblematischen Krankheitsbild“ der Spätmoderne geworden ist. Es ist dies freilich ein Bessergestelltenleiden, quasi die Pathologie der Gewinner.
Der Kult des Singulären, Abweichenden, Besonderen erweist sich als eine der erfolgreichsten Strategien im Kampf um eine Aufmerksamkeit, die auch ökonomisch messbar ist: ein und dasselbe Tattoo etwa ziert nicht nur „viele“, sondern auch Fußballspieler oder Rockstar, emblematischen Figuren des Wilden und Ungezähmten, bei denen sich inszenierte Dissidenz und ökonomischer Erfolg verbinden. Gerade solche Stars aus Sport und Pop könnte man als Speerspitze jener Ökonomie der Singularisierung begreifen, die sämtliche Bereiche spätmoderner Gesellschaften durchziehen. Aber die Identifikation von Frustrierten mit Etablierten ist ebenso kurzfristig wie fraglich, und: Aufmerksamkeit setzt Reckwitz als Wert per se, vermeidet aber jede Diskussion darüber, wofür oder besser worin man diese investiert.
Vor allem aber: Laut Reckwitz ist das spätmoderne Subjekt zur Performanz in Permanenz angehalten. Es muss sich als einzigartig und attraktiv inszenieren, und das auch noch glaubhaft. Das Einzigartige aber existiert nur, indem es aufgeführt wird. Danach ist die Aufführung ebenso wie die damit verbundene Einzigartigkeit vorbei, die Existenz Geschichte, der Mensch geschichtslos. Wie könnte er da noch „Existenz“ beanspruchen? „Das Rating ist die narzisstische Introspektion eines Systems, das sich nicht mehr entwickeln kann. So wie jemand, dem nichts mehr einfällt, außer das Angesammelte immer wieder neu zu sortieren.“ (Metz/Seeßlen 2012)
3 Der Themenkreis „singularisierte Arbeitswelt“
Der eben angedeutete personale Wertewandel wird in diesem Kapitel unter arbeitsweltlichen Aspekten vertieft. Die Krise der Entkopplung meint auch eine Abwertung von Arbeitsweisen, die nicht der Idee des Besonderen entsprechen: Sie würden nicht mehr ernst genommen und auf diese Weise der Anerkennung beraubt. Auch so verhärten sich neue Grenzen zwischen Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die an der kreativen – und doch gar nicht so kreativen – Industrie mitwirken, eigene Vorstellungen guten Lebens produzieren, die soziomedial zur Norm erhoben werden. Auf der anderen Seite stehen weit abgeschlagen diejenigen, die nicht an dieser Form der Produktion mitwirken können.
So wird das Besondere, was kreative und wissensproduzierende Berufe antreibt, zum Distinktionsmerkmal. Diejenigen, die nicht kreativ, besonders, innovativ sind, sondern „nur“ ihrer Arbeit nachgehen, verdienen in der Gesellschaft der Singularisierung keine Anerkennung:
„Grundlegend ist nun ein Dualismus zwischen den hochqualifizierten Tätigkeiten in der Wissens- und Kulturökonomie einerseits und den einfachen Dienstleistungen sowie sonstigen standardisierten Tätigkeiten andererseits. Die qualifizierten Wissensberufe, die kulturelle Singularitätsgüter verfertigen, können in der Spätmoderne Legitimität, Status und Ressourcen beanspruchen, während die funktionalen, ‚profanen‘ Arbeiten an Legitimität, Status und Ressourcen verlieren.“
Das muss man erstmal sacken lassen.
In den fünfziger und sechziger Jahren dominierten sogenannte Pflicht- und Akzeptanzwerte: Es ging darum, so zu sein wie die anderen. Seit den siebziger Jahren werden Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung immer wichtiger. Da spielt 68 eine Rolle, aber auch die lange historische Tradition der Romantik. Digitalisierung fördert die Singularisierung. Data-Tracking ermöglicht, den einzelnen Konsumenten zu adressieren. Vor allem aber ist das Internet ein Sichtbarkeitsmarkt in einer Radikalität, wie sie vorher nie da war. Man könnte sagen: Das Internet trainiert einen auf das Singuläre hin.
„Kein Arbeitnehmer mehr, nirgends“, erschrickt Berthold Vogel auf soziopolis. „Nur noch kulturalisierte Einzelkämpfer, die ihre singularisierte Marke zu Markte tragen und zuvorderst an sich selbst zu denken haben“, setzt er fort und zitiert – Schröders „Ich-AG’s“ lassen grüßen – das „unternehmerische Selbst“ ebenso wie den „Arbeitskraftunternehmer“ oder das „Kreativsubjekt“ bis hin zum projektgebeutelten „Netzwerker“.
Arbeit werde also nur noch nach dem Gelingen ihrer Performance und damit der Valorisierung durch das Publikum bewertet, nicht mehr unter dem Aspekt sachlicher Korrektheit. Indiz dafür seien z.B. die neuen Instanzen des Casting und des Assessment, die klassische Prüfungen nach formellen Korrektheits-Indizes abgelöst haben. Nicht das Können, sondern der Erfolg ist das letztlich entscheidende Kriterium sowohl in der Arbeits- als auch in der Produktionswelt. Aber da er unberechenbar, unvorhersehbar, unprognostizierbar sei, sind Arbeit und Produktion um ein vielfaches risikobehafteter als in der traditionellen Industriewelt. Ob diese Risiken andere, schwerwiegendere sind als zu nicht-singularistischen Zeiten, diskutiert Reckwitz – wir ahnen es – nicht.
Die Risiken seien gar unvermeidbar: Anders als im fordistischen Kapitalismus verlangt die neue junge Klasse des arrivierten Mittelstandes in ihrer Berufswelt mehr als das bloße routinemäßige Anfertigen und Abliefern von standardisierten Produkten. Andererseits sei die Herstellung von Gütern, die publikumswirksam sein wollen und damit in der Aufmerksamkeit mit vielen anderen Singularitäts-Gütern konkurrieren, ein hohes Wagnis. Gerade Individuen mit gesteigertem Selbstverwirklichungsanspruch bewegen sich in einer Spirale ständiger Auf- und Abwertung, in der sie sich nicht selten erschöpfen, weil der schnelldrehende Plattformkapitalismus nur wenige Stars und Unternehmen prämiert.
Man übersetze das mal in die Logik von „DSDS“ (RTL): vorgeblich Singende wetteifern vor vorgeblich Sangeskundigen, um nicht in ihren (profanen?) Berufen, sondern in der von ihnen gefühlten bis gewollten Berufung jene auch materielle Anerkennung zu finden, die andererseits nur ein kulturkapitalistisches Unterhaltungssystem gewähren kann, das sich der vorgenommenen Wertzuschreibung durch „Fremde“ sicher sein muss. Einem Glücksgriff stehen dann Unmengen von Misserfolgen gegenüber; und da die Länge dieses Erfolgs kaum planbar ist, muss nach einem Jahr der nächste „Glücksgriff“ her.
So gewann 2011 eben diese Casting-Show mit „Call My Name“ der damals 18jährige Pietro Lombardi, ein Schulabbrecher mit italienischen Wurzeln, der im Rahmen eines Minijobs auf 400-Euro-Basis als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts arbeitete. Seitdem macht er weniger Schlagzeilen mit vier teilweise verrissenen, eher erfolglosen Alben, sondern vor allem als Teilnehmer von Reality-Shows und Doku-Soaps sowie mit der multimedialen digitalen Vermarktung seiner Beziehung, Hochzeit, Vaterschaft und Scheidung (u.a. als Buchautor „Heldenpapa im Krümelchaos: Mein neues Leben“).
Noch in den 70er Jahren wäre ein berufsloser Mittzwanziger wie er von der Gesellschaft als geschiedener und gescheiterter Hallodri wahrgenommen worden. Nach einer wenige Wochen dauernden mediengestützten, singularisierenden Performance gilt er heute als deutscher TV-Star. Während man früher in seinem Leben ein Ziel verfolgte und so dem Leben einen Sinn gab, ist man heute der Kurator der permanenten Ausstellung seiner eigenen Biografie und erhebt deren Perfektionierung zum eigentlichen Lebenssinn. Es ist eine sehr stark nach außen gerichtete Lebensweise, die den Menschen in der Spätmoderne und durch ihre Faszination für das Singuläre gefangen hält. Sollten es tatsächlich solche Narrative wie die Lombardis sein, die der Autor unwidersprochen als kultur-, ja inzwischen gesellschaftsdeterminierend ansieht?

Pietro & Sarah Lombardi. Quelle: https://image.gala.de/20236164/uncropped-0-0/a8edbc88ed5abe6e005825c7d7f48716/ut/engels-ge--8970314-.jpg
Die „neue Unterklasse“ nun entwirft Reckwitz so, als sei sie erst durch den singularistisch-kulturalen Strukturwandel besonders beleidigt, befindet Richartz, und nicht etwa durch die Tatsache, dass sie durch die Demütigungen z.B. des Hartz-IV-Systems permanent an ihre Minderwertigkeit erinnert wird. Interessanterweise räumt der Wissenschaftler der Beschreibung eben dieser „Abgehängten“ mit ihrem Hang zu populistischen Kultur-Essentialismen und neo-gemeinschaftlichen Identitäts-Bünden den geringsten Raum ein, obwohl es einem Soziologen innerhalb seines Entwurfs doch insbesondere um die Verantwortung einer Befriedung eben jener Gruppen als Vielheiten gehen sollte.
Doch Reckwitz beschreibt die neue singularistische Mittelklasse so repetitiv, bis der Leser ahnt, dass sich der Autor mit ihr am besten auskennt, weil er ihr entstammt: Bei ihm erscheinen alle akademisierten Subjekte mit wie auch immer gearteten kulturellen Berufshintergrund als Gewinner der Stunde. Das blendet nicht nur die Massen arbeitsloser Künstler, Musiker, Schauspieler und anderer Wettbewerber im Kreativ-Feld unserer Gesellschaft aus, sondern auch das Bildungs-Prekariat an sich. So absolut, wie Reckwitz den Einfluss der heutigen Akademikerklasse für den von ihm ausgemachten Strukturwandel der Moderne setzt, ist er faktisch wohl nicht. Ob da ein wenig private Rechtfertigung, gar Selbstgefälligkeit dahinter steckt? Dass die Bildungsexpansion Akademisierung bedeutet, was umgekehrt die mittlere Ausbildung entwertet, bleibt ebenso unreflektiert wie die Tatsache, dass durch das Überangebot von Akademikern und das Fehlen angemessener Arbeitsplätze die Unzufriedenheit innerhalb dieser Akademikerschicht zunimmt.
Das Primat des singularistischen Strukturwandels fußt für Reckwitz also auf drei Faktoren:
- Die sozio-kulturelle Authentizitätsrevolution („Die Spätmoderne erweist sich so als eine Kultur des Authentischen, die zugleich eine Kultur des Attraktiven ist“ – auch diese interessante Gleichsetzung wird leider nicht diskutiert),
- die Transformation zu einer postindustriellen Ökonomie der Singularitäten, die nicht nur die Sphäre der Güterproduktion umfasst, sondern auch „events“ wie etwa globale Sportereignisse, Konzerte, Filmfestivals mit ihrem mondialen Publikum (singuläre Ereignisse gestalten sich immer im Hinblick auf ein Publikum und ein Gesehenwerden – sie werden performt) und
- die technische Revolution der Digitalisierung, die einerseits die Performance erst sichtbar macht und zur Geltung bringt, andererseits den (deutschen?) Arbeitsmarkt in Jobs für Hoch- und Niedrigqualifizierte spaltet.
Dabei sind Singularitäten keine statischen Faktoren in der Kultur, sie müssen immer wieder aufs Neue kreiert werden – durch die Praktiken Beobachten, Bewerten, Hervorbringen und Aneignen. Dadurch lösen sie in ihrer Prominenz die traditionelle Güterproduktion ab: Nicht mehr die Warenwelt ist jetzt begrenzt, sondern die Aufmerksamkeit und Anerkennung des Publikums. Güter – im umfassenden Sinne – sind in der gegenwärtigen Kultur nicht mehr knapp, sondern im Überfluss vorhanden. An ihnen herrscht kein Mangel, sondern eher Verschwendung, wie jüngst Berichte zeigen, wonach Amazon Ladenhüter und Rückläufer einfach vernichtet.
Dieser kulturelle Paradigmenwechsel bringt viele neue Probleme mit sich, die Reckwitz im Vortrag „Die Analyse des Kreativitätsdispositivs“ auf Vimeo genauer beschrieb: Sobald Kreativität gesellschaftlich eingefordert wird, gehen damit Leistungszwang und dauerhafte Konkurrenz einher. Bei einer Überproduktion kultureller Güter kann davon nur ein kleiner Teil vom Publikum wahrgenommen werden, vieles bleibt unsichtbar. Wer regelmäßig ästhetische Leistungen konsumiert und darin Genuss und Befriedigung findet, verliert bei Reizüberflutung seine Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit. Es entsteht ein Gefühl, das Reckwitz eine „widersprüchliche Unbefriedigtheit“ nennt: man leidet darunter, dass es gleichzeitig zu viel und zu wenig Neues gibt, dass im Meer des vermeintlich Neuartigen nichts wirklich Neues mehr nachkommt. Letztendlich hat es das Kreativitätsdispositiv bisher nicht geschafft, tatsächlich neue Gesellschaftsmodelle zu entwickeln und durchzusetzen.
4 Der Themenkreis „digitalisierte Kulturmaschine“
Ein Schlüsselbegriff von Reckwitz, den er schon in seinem Buch „Gesellschaft und Ästhetik“ einführte, lautet „Kulturkapitalismus“ – der Prozess, an dessen Ende bestimmte Dienstleistungen oder Waren, Erfahrungen oder Räume kulturalisiert worden sind: Eine Bar mit den richtigen Gästen, ein neues Hotel in einem besonderen Space, eine bestimmte Handtasche – Aufenthaltsräume und Gebrauchsgegenstände erhalten im Kulturkapitalismus eine sakrale Qualität, eine Art „Aura“ (Walter Benjamin). Ihnen wird Einzigartigkeit zugeschrieben, sie werden als optimaler Ausdruck des Besonderen aufgefasst – und hochwertiger als einzigartig geht nicht. In Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit wird nicht nur das Kunstwerk zur Ware. Nein, die Ware wird, wenn sie geschickt genug mit Bedeutung angereichert und im aktuellen Attraktivitätsdiskurs platziert wurde, zur Kunst.
„Die Gesellschaft der Singularitäten betreibt eine tiefgreifende Kulturalisierung des Sozialen. Sie spielt ein großes soziales Spiel von Valorisierung und Singularisierung einerseits, von Entwertung und Entsingularisierung andererseits und lädt Objekte und Praktiken mit einem Wert jenseits von Funktionalität auf“, schreibt Reckwitz und beschreibt damit, dass auch Kunstwerke zu einmaligen und wertvollen werden können. Aber wie genau das vor sich geht, erklärt der Autor eben nicht. Sein Modell bleibt ein deskriptives. Dafür überträgt er es vom Kunstmarkt auf andere Bereiche: kreative Arbeit, temporäre Projekte, persönliche Performance.
Die „creative economy“ sei das Vorbild, die „alte Mittelklasse“ der Angestellten und die Unterklasse der Dienstleister und Arbeiter gälten nichts mehr. Auch wenn man die Bedeutung der Kulturökonomie nicht ganz so hoch veranschlagt, lässt sich die mentalitätsprägende und gesellschaftlich polarisierende Kraft der beschriebenen Phänomene nicht abstreiten. Die creative economy ist nach Auffassung des Autors „von jenem Künstlerdilemma geprägt, das sich im 19. Jahrhundert ausgebildet hat“: Ihre Arbeit soll ihr, wie dem Künstler sein Werk, Sinn und Befriedigung geben. Gleichzeitig aber funktioniert dies nur, wenn sie den Bedürfnissen des Marktes und der Konsumenten entspricht. In der Arbeitswelt erwirtschaftet die Kreativbranche wesentlich weniger als die Automobilbranche.
Sozialer Träger dieses kreativen Wandels ist bei Reckwitz die „Creative Class“, die er aber nur vage definiert. Kreativ ist hier alles: das kulinarische Gewerbe, die IT-Unternehmen, die Wissenschaft. Wie sehr Reckwitz ein spezielles Segment im Auge hat, wird deutlich, wenn er das Spitzenrestaurant als Beispiel der Kreativbranche nennt. Allerdings spricht er bei der Beschreibung dieser kulturtragenden Schicht die Sprache von Trendbüros und Eventmanagern: Man liest von einzigartigen Kompetenzbündeln, einmaligen, gleichwohl seriellen Events, Kreativindividuen, die mühelos zwischen Schubert und Sneakers wechseln, und von Projektarbeitern, die ihre ganze Persönlichkeit in ihre Tätigkeit setzten. Die durchaus stupide Arbeit in diesen Branchen fällt unter den Tisch, denn Reckwitz‘ Kulturbegriff zielt auf das, was von den Akteuren oder ihren Arbeitgebern selbst als besonders gewertet wird – ob auch originell, sei dahingestellt.
Reckwitz hält daran fest, dass Wirtschaft und Gesellschaft flächendeckend dem ästhetischen Imperativ der Kulturökonomie unterstehen. Warum fortbestehende Routinen als bloßer Hintergrund der Singularisierung zu betrachten sind, begründet er nicht. Ebenso wenig, dass es eigentlich um eine Doppelbewegung von Standardisierung und Singularisierung geht, wie sie sich beispielhaft in den Rasterbildungen des Big-Data-Sektors ausdrückt. Stattdessen führt er aus, dass die Selbstdarstellung als Mittel zum Zweck der Vermehrung des eigenen kulturellen und sozialen Kapitals das Zentrum dieses neuen Gesellschaftsspiels bildet. Wer nicht dabei sein will oder kann, muss sich letztlich auch politisch artikulieren. Reckwitz sieht in diesem schleichenden Prozess der Ausgrenzung der prekären oder eher konservativ eingestellten Bevölkerungsanteile auch einen wichtigen Grund für das Erstarken neuer Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums.
Ein interessanter Gedankengang, denn auch Gemeinschaften bewegen sich zu großen Teilen auf kulturellen Märkten: Identitätspolitik, Kulturnationalismen, selbst religiöse Fundamentalismen sind alles andere als ausschließlich mit sich selbst beschäftigte Subkulturen, sondern konkurrieren mit Gütern, Waren und anderen politischen Instanzen auf einem Sichtbarkeitsmarkt der Identitäten um Attraktivität und Anhänger. Da sind nun allerdings die Grenzen zur Gleichmacherei von allem und jedem fließend; das ist weder kulturspezifisch noch politisch hilfreich.
Außerdem berge dieser Trend zur Selbstverwirklichung und permanenten Selbstdarstellung jede Menge Enttäuschungspotenzial: Wer den Sinn seines Lebens nicht in sich selbst, sondern in seinem Erscheinungsbild und dem schwankenden Urteil der Anderen sucht, muss sich auf Rückschläge gefasst machen. Die Welt der Spätmoderne ist aber eine Welt im Getriebensein durch einen Zwang zu Selbstvergewisserung und Bewertung, eine Welt der permanenten Sucht nach Anerkennung: durch Selfies, Kommentare und Facebook-Einträge, Instagram-Feeds, Votes und Likes. Ohne diese permanenten Bestätigungs-Rituale fehle der Existenz die quantifizierbare Rückversicherung und der Selbstbestätigung der Nachweis von außen. Lieber Kinderbilder liken als selbst Kinder haben, ist man versucht zu behaupten.
Indem man dem Zwang zu bewerten nachgäbe, nähme man teil an dem großen Spiel der gegenseitigen Bestätigungen, und indem man sich möglichst schillernd, aufregend und singulär präsentiert, sublimiere man den Verlust allgemeiner und gemeinschaftlicher Merkmale, die früher tragfähig und Identität stiftend waren, heute jedoch nicht mehr ausreichen, um einen entsprechend hohen Preis für eine (imaginierte) Attraktivität zu erzielen. Daneben ist dieser neue urbane, kosmopolitische und auf neuen kulturellen Praktiken basierende Lebensstil nicht in allen Gesellschaftsschichten angekommen. Der Trend zum Besonderen wird bei Reckwitz von der Digitalisierung und der Kultur jener neuen Mittelklasse vorangetrieben, die ganz auf Selbstentfaltung setzt und im „authentischen“ Konsum zu sich selbst findet.
Den Widerspruch zur Kuratierung sieht er nicht, wohl aber Thomas Steiner, der in der Badischen Zeitung völlig zu Recht darauf verweist, dass es bspw. im Kino nicht darum geht, den neuesten Umweltfilm eines Ex-US-Vizepräsidenten zu sehen, sondern vielleicht nur darum, sich einen schönen Abend zu machen: Thriller oder Komödie ist keine Frage der Singularität, sondern des bevorzugten Genre. In allen diesen Fällen geht es nicht um das Besondere, sondern um das Gleiche, das Gemeinsame, das Gewohnte. Konformität statt Singularisierung.
Im Kampf um Sichtbarkeit vor allem in den sozialen Medien wird zur Gretchenfrage, was die Menschen antreibt – oder ob sie vielmehr Getriebene sind. Eine interessante Ferienreise kann man machen, weil man selbst für sich neue Impulse und Erlebnisse sucht; andererseits kann man die Fotos davon auf Instagram verbreiten. Und nur wenn diese unvergleichlich sind, haben sie eine Chance auf Sichtbarkeit. Beide Motivationen können sich gegenseitig verstärken, aber auch in einen Widerspruch münden. Denn in der gegenwärtigen Hyperkultur gehe es nur um Versatzstücke, die man sich von außen nimmt und dann anzueignen versucht, so Reckwitz in einem Interview. Die Singularisierung sei kein Spiel mit Etiketten, sondern eine Praxis, die einen die Dinge anders betrachten, in ihrer Komplexität wahrnehmen lässt.
Der Kampf um Absatz und Aufmerksamkeit in der globalen Konkurrenz und die Vermarktlichung des staatlichen Sektors machten dennoch den „Performer“ zum Leitbild, der, um seinen Markenwert zu halten, auf sich aufmerksam machen muss. Statt „nur“ eine bestimmte Qualifikation zu haben, sollte es ihm vielmehr darum gehen, „unvergleichliche Profile und außergewöhnliche Leistungen zu erbringen“. Der Laufsteg der Besonderheiten ist das personalisierte Internet, das eine narzisstische Subjektbildung fördert und über den digitalen Plattformkapitalismus eine Spirale ständiger Auf- und Abwertung am Laufen hält. Im Grau versinken darüber die Tugenden der industriellen Moderne: Konstanz, Pflichtbewusstsein, Gewohnheitsethos.
5 Der Themenkreis „singularistische Lebensführung“
In diesem Kapitel, das durchaus als Verlängerung des Kulturkapitels und dramaturgischer Höhepunkt in einem Buch zu lesen ist, in dem insgesamt kaum ein Spannungsbogen angelegt scheint, kulminieren die Thesen von Reckwitz. Aus meiner Sicht stehen drei im wissenschaftlichen Fokus, die auch andere Rezensenten mehr oder minder ähnlich gewichtet wiederspiegelten:
- 1) die auch demokratietheoretisch bedeutsame Begründung der Um- und Neu-Schichtung von Klassen mit Gewinnern und Verlierern,
- 2) der Diskurs um das „Kuratieren“ des eigenen Lebens, oft unter Einbezug der Touristik,
- 3) die Argumentation zur Um- und Abwertung tradierter Vorstellungen u.a. im Bildungssektor.
Zu 1) Während bis etwa Mitte der 1970er Jahre die gesellschaftlichen Unterschiede so gering waren, dass Helmut Schelsky den Ausdruck der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ prägen konnte, hätten wir es heute mit einer diversifizierten, durch den Prozess der Digitalisierung befeuerten kulturellen Klassengesellschaft zu tun, in der eine singularistische, medial narzisstische Lebensführung ebenso ermöglicht wie erwartet wird, um einen Attraktivitätsmarkt zu bedienen. Es entstehe eine kulturelle Klassengesellschaft, in der es Gewinner und Verlierer gibt.
Gab es einst in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft eine Art Fahrstuhleffekt, bei dem alle in gewisser Weise vom wirtschaftlichen Aufschwung profitierten und die Lebensstile eher konformistisch ausgerichtet waren, dominiert in der kulturellen Klassengesellschaft ein „Paternostereffekt“, d. h. es kommt zur Vergrößerung der Abstände zwischen einer neuen Mittelklasse mit hohen Bildungsabschlüssen als diffuse Summe von Einzelkämpfern und einer neuen Unterklasse mit niedrigen formalen Abschlüssen, wie Reckwitz schon zuvor formuliert: „Diese Polarisierung auf der Ebene von Bildung und kulturellem Kapital ist das zentrale Merkmal, welches die Sozialstruktur der spätmodernen Gesellschaft prägt“ (S. 280). Dabei bediene sich die neue Mittelklasse ungeniert im gesamten kulturellen Ressourcenhaushalt, inklusive der Vergangenheit, so Reckwitz in einem Zeit-Interview:
„Man wohnt in Altbauwohnungen, hat ein Tattoo und macht Tai-Chi – historische Tradition, geografische Fremdheit und fremde Klasse werden sich angeeignet, alles drei übrigens ein sehr guter Fundus für das Singularisierungsspiel.“
Neben diesen beiden Klassen unterscheidet Reckwitz noch eine sehr kleine Oberklasse und die „alte“, d. h. nicht-akademische Mittelklasse. Superreichtum ist zwar unter Gerechtigkeitsaspekten skandalös, aber nicht das prägende Element für die Sozialstruktur der westlichen Gesellschaften. Mit einer Oberschicht müsste allerdings über eine Viertelgesellschaft gesprochen werden, was wiederum die wohlgeordneten Koordinaten im vorliegenden Theoriegebäude leicht durcheinander bringen würden, konstatiert Felsmann. Die Mittelklasse ist gekennzeichnet durch ein mittleres kulturelles und ökonomisches Kapital und bildet ca. ein (tendenziell schrumpfendes) Drittel der Bevölkerung.
Eingezwängt zwischen ca. je einem Drittel Unter- und einem Drittel neuer Akademikerklasse versucht die alte Mittelklasse wie ein soziales Auslaufmodell noch einen „normalen“ Lebensstil zu führen, der allerdings immer weniger „allgemeingültig ist, er ist nicht mehr Mitte und Maß, sondern lediglich Mittelmaß“ (S. 282). Einst etwas Positives, Allumfassendes, würde „Mitte“ heute eher mit dem Durchschnittlichen assoziiert. Diese Defensive der alten Mittelklasse greift er in seinen politischen Betrachtungen erneut auf, um damit Wahlerfolge populistischer Parteien zu erklären.
Gesellschaftlich wirkt sich das Gebot des attraktiven Lebensstils als Kulturalisierung der Ungleichheit aus. Weniger Vermögensverhältnisse als die soziale Norm der Auffälligkeit führen dazu, dass sich eine in der alten Pflichtethik gefangene Unterschicht mühsam durch ein als wertlos empfundenes Leben kämpft. Der Lebensstil der „Kulturalisierungsverlierer“ ist defizitär, ohne Perspektive auf Lebensqualität und Anerkennung. Sie leben ein Leben mit zerstückelten kurzen Einzel-Zeithorizonten, bei dem es nur darum geht, Störfälle zu vermeiden bzw. zu überwinden. Ein besonderer krasser Fall sind Attentäter, die den gesteigerten Wert des Besonderen usurpieren und ins Makabre verkehren. Reckwitz versteht sie als Rache der Deklassierten an einer als erdrückend empfundenen Meritokratie.
Der Autor konzentriert sich – worauf er ausdrücklich hinweist – auf jene neue akademische Mittelschicht und deren Versuch, gegenüber den neuen Anforderungen an die individuelle Persönlichkeit (Identität, Authentizität), Performance im gesellschaftlichen Umfeld und in der Arbeitswelt zu bestehen. Gleichzeitig wird auf das sich ändernde Verhältnis bzw. auf die wachsende Kluft der sozialen Schichten zueinander und deren Ursachen hingewiesen: Ein Drittel Akademiker – das gab es zuvor nicht. In den fünfziger Jahren war das noch eine winzige Elite von fünf Prozent der deutschen Gesellschaft. Diese große neue Gruppe forciere einen Wertewandel, weg von Normen und Pflichten hin zu Selbstentfaltung und Liberalisierung.
An dieser Stelle bereits kommen mindestens drei Schlüsse in den Sinn – dem Leser intensiver als Reckwitz. Zum ersten bedingt das Verschwinden der Mitte eine politische Krise: Eine Gesellschaft, die einer sozialen Logik der Besonderheit folgt, die permanent damit beschäftigt ist, Eigenschaften zu bewerten, verliert die Dynamik der Gemeinsamkeit. Und ganz ohne die ist demokratische Handlungsfähigkeit nicht denkbar. Was hält da ein Gemeinwesen noch zusammen? Distinktion statt Solidarität – sollte das wirklich die Verhaltensmaxime der spätmodernen Gesellschaft sein, stehen wir am Anfang neuer Klassenkämpfe. Zwar wurde in der Folge der emanzipatorischen Revolte von 1968 normierter gesellschaftlicher Pflicht- und Verbotskanon hinweggefegt, dabei aber auch das Allgemeine dereguliert und durch einen radikalen Selbstverwirklichungs- und Besonderheitsanspruch des Einzelnen ersetzt, der jetzt bittere Früchte trägt.
Die extremen Unterschiede zwischen Arm und Reich verschärfen die Entwicklung drastisch und lassen, was verbindet, immer mehr in den Hintergrund treten. Das ist Gift für eine soziale und politische Landschaft und eine reale Gefahr für die Demokratie – zumal Reckwitz an keiner Stelle die Grenze zwischen Individualismus und Egoismus thematisiert: aus dem Text lässt sich eine solche ebenso wenig herausfiltern wie die negativ konnotierte Charaktereigenschaft. In der DDR lebte die Mehrheit der Bevölkerung ein „gesamtgesellschaftliches Verantwortungsgefühl“, das sich zunehmend als völliger Gegenentwurf zum Egoismus entpuppt und seine populistisch-patriotische Anverwandlung nicht leugnen kann: wer asozial unverantwortlich handelt und nicht an die Zukunft der Kinder und des Landes denkt, gilt als End-Gegner.
Die Kehrseite solcher Entwicklung ist das Risiko, dass die neue Mittelklasse, die alte Mittelklasse und die neue Unterklasse selbst wie Parallelgesellschaften nebeneinander existieren, weil es wenig gemeinsamen Erfahrungs- und Diskursraum mehr gibt, gesteht Reckwitz selbst ein. Aber ist die Idee wirklich ein „populistischer Mythos“, das Rad zurückzudrehen „in die kulturell homogenen, staatlich regulierten Gesellschaften der industriellen Moderne“? Der Autor relativiert selbst, dass in der Gesellschaft der Singularitäten zwar immer mehr Besonderheiten, Außergewöhnlichkeiten, kulturelle Partikularismen florieren, aber die Politik hier stärker regulierend eingreifen sollte mittels einer Reform des Liberalismus: von einer auf Differenzen und Öffnung setzenden Variante zu einer stärkeren Regulierung des Sozialen und Kulturellen, da es letztlich darum gehe, „das Allgemeine gegenüber dem Besonderen neu auszutarieren“. Wie diese Regulierung aber vonstattengehen kann, ohne zugleich historisierend zu sein… An dieser Stelle drängt sich dem Leser, wieder mal, der Begriff „Wunschbild“ auf.
Zum zweiten die unausgesprochene Synonymität von „besonders“ und „erfolgreich“, deren abstruse Auswüchse oben schon bei Lombardi gezeigt wurden. Ist der, der heraussticht, auch gut? Dass er der bessere Selbstdarsteller und -vermarkter und damit Aufmerksamkeitsfänger ist – klar. Aber ist er auch der bessere Arbeiter, Angestellte, Künstler, ja Politiker – oder ist es nicht eher so, dass Fristigkeit im Effekt auch Fristigkeit im Erfolg nach sich zieht? Denn das Singuläre wendet sich gegen Verallgemeinerungs- und Angleichungsbestrebungen einer routinisierten Arbeiter- und Angestelltentätigkeit, wie sie in der fordistischen Moderne vorangetrieben wurden: Effizienz, Rationalität, Sachlichkeit, Standardisierung, Routine, Normativität und Affektarmut; ja kippt sie ins Gegenteil.
Das zeitgenössische Subjekt, welches laut Reckwitz das Neue gegenüber dem Alten, das Abweichende gegenüber dem Standard, das Andere gegenüber dem Gleichen bevorzugt, bezieht aus der Arbeit an der Besonderheit das Gefühl einer Souveränität, die es nicht nötig hat, sich an überkommene Regeln zu halten. Doch die neuen Sieger sollten nicht allzu früh frohlocken, da sie der Paternoster-Effekt ganz schnell wieder nach unten führen kann, wenn sie im großen Präsentationsspiel der Einzigartigen nicht dauernd am Ball bleiben.
Zudem sind nach Reckwitz‘ Rechnung zwei Drittel gegenüber einem avantgardistischen Drittel in die Defensive geraten, d.h. die mediale Präsenz dieses einen Drittels begründet deren kulturelle Dominanz – mit dem auch oben schon erwähnten Phänomen erfahrener kultureller Entwertung und Herabsetzung. Denn während die alte Mittelklasse sich zwar materiell behauptet, gerät sie kulturell ins Hintertreffen und empfindet dies in einem kulturalisierten Kapitalismus als Niederlage. Die „neue Unterschicht“, die weder durch Bildung noch durch Geschäft ihren Status festigen kann, ist es, die an allen Fronten verliert.
Und zum dritten mag man vielleicht statistisch eine akademisches Drittel konstatieren – das aber sagt nichts über das Niveau dieser Akademiker aus und erst recht nicht, dass damit oft die bestenfalls Mittelmäßigen zur Elite werden, die dazu nicht berufen sind. Die Klagen über die Studierfähigkeit von Abiturienten samt ihren desaströsen Deutschkenntnissen gehörten hier ebenso hin wie die Trennung von Leistungs- und Funktionseliten: letztere maßen sich als Verwalter die Rolle von Gestaltern an. Im Westen gibt es mehr Menschen mit akademischen Abschlüssen als je zuvor, und auch wenn sie nicht die materiell reichste Schicht bilden, so verfügen sie aber über Einfluss, Deutungshoheit und Geschmacksherrschaft. Es sind ihre Werte und Ideale, die in den Medien überrepräsentiert sind, ihre Interessen, die politisch geltend gemacht werden, ihre Ideen, die Diskurse prägen.
Zu 2) „Die neue Mittelklasse kann nicht nur auf berufliche Anerkennung zählen, sondern entfaltet eine kulturorientierte kuratierte Lebensführung, in der sie in allen Bereichen – von der Gesundheit bis zum Kosmopolitismus, von der Bildung und Erziehung bis zum Wohnumfeld – am hohen (ethischen und ästhetischen) Wert arbeitet und als Trägerin eines wertvollen ‚guten Lebens‘ erscheint“, lautet ein Diktum von Reckwitz. Ein anderes:
„Die geschmackliche Dichte des Essens, die Vielseitigkeit eines Reiseziels, die Besonderheit des Kindes mit all seinen Begabungen, die ästhetische Gestaltung der eigenen Wohnung – überall geht es um Originalität und Interessantheit, Vielseitigkeit und Andersheit“.
Das Gute wird zum guten Gewissen; das Schöne zum ethisch Korrekten, könnte man zusammenfassen. Diese Doppelhelix des ausgestellten Schönen und Guten, bspw. als gutes Gewissen in geschmackvollem Wohnumfeld, das Ineinssetzen des Satten und Selbstgerechten kann auch Abscheu hervorrufen. Den Sozialtypus identifizierte der amerikanische Essayist David Brooks schon vor über 20 Jahren, in den Jugendjahren des kulturellen Kapitalismus, mit ironisch gebrochener Zustimmung als „Bobo“: bourgeoise Bohemiens, deren anspruchsvoller (und preisintensiver) Lifestyle das ethisch Korrekte mit einschließt und nach einer originellen Synthese des zugleich Saturierten und Liberal-Offenen sucht.
Solche Originalität stellt sich allerdings nicht von selbst ein, sie muss „kuratiert“ werden, ob es nun um Essen, Reisen, die Wohnung oder auch die Partnerschaft geht. Wo früher die Querschnittspraxis das Konsumieren als „Verbrauchen“ war, ist heute die Querschnittspraxis das Kuratieren als „Gebrauchen“. Früher befand sich der Konsument in der Rolle des Wählenden, heute findet die Wahl nicht mehr nach zweckrationalen, sondern nach kulturellen Kriterien statt. Die Optionen sind nicht mehr vorgegeben oder normativ zwingend, sondern konkurrieren als Möglichkeiten zueinander, für die man sich nur unter bestimmten Umständen wirklich entscheiden muss.
Eine der entscheidenden Erklärungen von Reckwitz lautet: „Singularisierung meint aber mehr als Selbstständigkeit und Selbstoptimierung. Zentral ist ihr das kompliziertere Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, die zu erreichen freilich nicht nur subjektiver Wunsch, sondern paradoxe gesellschaftliche Erwartung geworden ist. Markant ausgeprägt ist dies in der neuen, der hochqualifizierten Mittelklasse, also in jenem sozialen Produkt von Bildungsexpansion und Postindustrialisierung, das zum Leitmilieu der Spätmoderne geworden ist. An alles in der Lebensführung legt man hier den Maßstab der Besonderung an: Wie man wohnt, was man isst, wohin und wie man reist, wie man den eigenen Körper oder den Freundeskreis gestaltet. Im Modus der Singularisierung wird das Leben nicht einfach gelebt, es wird kuratiert.“ Auffällig ist erneut, dass bei der „paradoxen gesellschaftlichen Erwartung“ kein Agens präsentiert wird.
Hartmut Rosa hat zur Besonderung allerdings alles Wesentliche geschrieben: „Etwa wenn ich von den Büchern, die ich kaufe, ein paar auch wirklich lese; wenn ich das Teleskop, das ich mir geleistet habe, auch wirklich benutze, oder von den Opernhäusern, die ich in Reichweite habe, auch eines besuche. Die Illusion gründet darin, dass viele Menschen inzwischen ihr Glück allein daran bemessen, wie viele Optionen sie haben. Ihre ganze Libido hängt mittlerweile am Erschließen von Optionen. Das aber ist ein kultureller Irrtum, denn das Leben wird erst dann gut, wo man eine Möglichkeit auch tatsächlich umsetzt.“
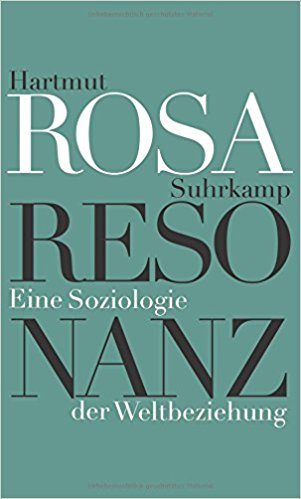
Rosa's opus magnum. Quelle: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41UrgrhT7wL._SX299_BO1,204,203,200_.jpg
Apropos Reisen: auffällig ist, wie oft Reckwitz – und auch seine Rezensenten – bei der Erklärung des Kuratierens Phänomene der Touristik in den Blick nehmen. „Verreisen“ kann zwar aus der Perspektive des Reisenden entweder als oberflächlicher Besuch oder tiefenstrukturelles Erkunden des Fremden gefasst werden – aus der des Publikums dagegen „nur“ als bebilderter und/oder kommentierter Aufenthalt im Fremden, den man so oder so wahrnimmt. Für primär muss Reckwitz‘ Feststellung gelten, dass der Massentourismus in die Defensive gerät. Menschen wollen immer mehr besondere Orte aufsuchen, die Reise zu einem besonderen Ereignis machen. Es geht nicht mehr um den Urlaub von der Stange, sondern um die einzigartige Erlebnistour.
„Menschen, Waren, Städte, Reiseziele, Konsumgüter und Karrieren – schlicht alles ist für Reckwitz heutzutage einzigartig, authentisch, außeralltäglich und exzeptionell, aufgeladen mit Ästhetik, Exklusivität und Eigensinn“, befindet Dieter Schnaas in der Wirtschaftswoche. „Entsprechend müssen in der Spätmoderne der Arbeitsplatz und die Abendgestaltung, der distinktive Einkauf und die allgemeine Lebensführung für Bewunderungen und Ergriffenheiten offen sein – müssen die Menschen jeweils selbst und ihre Mitmenschen affizieren, sei es nun ein Opernbesuch oder ein Eröffnungsspiel, ein Bungee-Sprung oder eine Städtereise, ein Sushi-Essen oder ein Facebook-Post.“
Im Kulturkapitalismus zähle nicht das meiste Geld, sondern, was man Besonderes damit anstellt, befand Peter Unfried in der taz. Ging es in der aufsteigenden Industriegesellschaft darum, dass sich jeder von der Schrankwand über den VW bis zum Adria-Urlaub Ähnliches leisten konnte, müsse heute alles singulär sein:
„Die Arbeit, der Bekanntenkreis mit Literaten und Schauspielern, der unvergessliche Iglu-Urlaub in Grönland, die Superschule der Kinder mit Bio-Catering, alles muss sorgsam kuratiert sein und einen hohen ästhetischen und ethischen Wert haben, bis hin zum einzigartigsten Kartoffelsalat, angemacht mit dem Öl einer griechischen Biobäuerin namens Danae.“
Es existiere also ein gewaltiger Unterschied zwischen „Urlaub machen“ und „Verreisen“, Reckwitz versteigt sich gar zur Formulierung „Imperativ zur Herausstellung von Einzigartigkeit“. Denn während der Pauschalurlaub eine sichere Bank war, verlangt die Individualreise Eigeninitiative und Kraft, sie beansprucht schon im Voraus und kann doch leicht enttäuschen: Die außergewöhnlichen Momente stellen sich nicht ein, die außerordentlichen Orte lassen einen unbeeindruckt. Die Verheißung ist groß, die Möglichkeit des Scheiterns ebenso: Selbst das Reisen spiegelt eine Grunderfahrung des Individuums in der „Gesellschaft der Singularitäten“.
Zu 3) Dass unter solcher Perspektive die Diversifizierung der Gesellschaft in ungezählte Reise-, aber eben auch Geschlechter-, Ernährungs- und Mobilitätstypen als völlig normal gilt, verwundert fast angesichts der Reckwitz’schen Klassenstruktur, die sich weniger mit harten Grenzen wie Wohlstand und Einkommen messen lasse, sondern entlang der nur vermeintlich durchlässigen Bildungsmembran geschehe. Dabei macht für Reckwitz die Diversifizierung selbst vor den Bildungsstätten nicht Halt: Viele Schulen versuchen, ein einzigartiges Profil, eine besondere Schulkultur und ein ausgewiesenes Spektrum an Bildungsangeboten auszubauen statt nur den allgemeinen Bildungskanon zu vermitteln.
Dass der Autor als Trägerschicht des Wandels die neue „hochqualifizierte Mittelklasse“ als „soziales Produkt von Bildungsexpansion und Postindustrialisierung, das zum Leitmilieu der Spätmoderne geworden ist“, stilisiert, der er selbst angehört, wurde bereits angemerkt. Das zeitigt aber zwei interessante Konstellationen. Zum einen den auch verschiedentlich angemerkten Vorwurf, mit Sätzen wie „Was diese Gruppe zusammenhält, ist weniger die Höhe des Einkommens – die durchaus schwankt – als die Kultur ihres Lebensstils“ betreibe Reckwitz eine Homogenisierung dieser Akademikerschicht. Damit werden die sozioökonomisch Unzufriedenen unter den Akademikern und damit die Statusinkonsistenz einfach eliminiert. Oder anders formuliert: Dahinter steht die Vorstellung, dass das ökonomische Kapital durch das kulturelle Kapital kompensiert werden soll.
In der Zeit bekräftigte der Autor etwas plakativ, dass der sich prekär fühlende Doktorand mit Freunden in Kalifornien, Paris und Barcelona heute in Wahrheit zur herrschenden Klasse gehöre. Trivial: ich habe zwar kaum Geld, gebe es aber für dieselben Dinge aus wie mein Professor. Wenn das nicht affirmativ ist, was dann? Reckwitz begründet das mit einem „kosmopolitischen Gefühl kultureller Selbstermächtigung“ im Sinne einer „anspruchsvollen Haltung gegenüber dem Leben“: Man fühle sich nicht nur berechtigt, die Welt zu bereisen und sich Fremdes kulturell anzueignen.
„Man hat den Anspruch an das eigene Leben, es ästhetisch und ethisch durchzustrukturieren: das gesunde Essen, die Pflege des Körpers, vielseitige Freizeit und interessanter Beruf, die guten Schulen für die Kinder, von denen man mehr erwartet, ebenso vom Partner.“
Diese Sichtweise übertüncht aber völlig, dass der „Firnis der Kultur“ sofort zu bröckeln beginnt, wenn der Abstieg aus der „Kulturoberschicht“ droht, sich die eigene Lebensführung als Lüge entpuppt, weil man sich Erwartungen ausdenkt und das Leben ein ganz anderes ist. Der Selbstverwirklichung folgt ihre Krise auf dem Fuß. Denn wer dieses gesellschaftliche Spiel des Präsentierens und Optimierens nicht mitspielt, verliert schnell sein Restguthaben an sozialem Kapital und landet im Off (bzw. Offline) der digitalen Spiegelkabinette.
Das kann sich auch darum sehr rasch vollziehen, weil es nach der singulären „Performance“ als Highlight oft nur noch abwärts geht, wie Sebastian Engelmann auf literaturkritik.de diagnostiziert:
„Wer sein Leben stets performativ als besonders, spannend, herausragend gestalten und hervorbringen soll, stößt schnell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Das Primat der Selbstverwirklichung durch Besonderheit verurteilt die Subjekte regelrecht zum Scheitern. Immer attraktiv und interessant zu sein, lässt alles, was vielleicht an der Langeweile positiv sein mag, verschwinden. Selbstverwirklichung wird somit zur stetigen Aufgabe, die zum Scheitern verurteilt ist, da die Ressourcen für den Umgang mit Enttäuschungen und dem Leiden an unglücklichen Erfahrungen nicht mehr vorhanden sind – sie wurden bereits zur Aufrechterhaltung des Besonderen verbraucht.“
Zum anderen ergibt sich, dass das neue Bildungsbürgertum ebenfalls enttäuscht werden wird, wenn es am Trugschluss festhält, mit universitären Abschlüssen bleibe es automatisch im vorderen Drittel. Die Akademiker forcieren zwar den Wertewandel, verantworten aber gleichzeitig den Kulturkapitalismus. Und der macht die „ungebildeten“ Dienstleister zur neuen Unterklasse, die sich durch ein als wertlos empfundenes Leben wursteln muss und mit Umverteilungen, Steuerreformen und Solidaritätsaufrufen nicht erreichen oder in ihrer Wut besänftigen lassen wird.
Insofern müsste man eigentlich von zwei Kulturalisierungen in der Spätmoderne sprechen. Die eine ist die Kulturalisierung der Lebensformen in Gestalt von „Lebensstilen“, die sich nach dem Muster eines Wettbewerbs kultureller Güter auf einem kulturellen Markt zueinander verhalten, also um die Gunst der nach individueller Selbstverwirklichung strebenden Subjekte wetteifern. Die andere richtet sich, wie eben angedeutet, auf Kollektive und baut sie als moralische Identitätsgemeinschaften auf, arbeitet mit einem strikten Innen-Außen-Dualismus und gehorcht dem Modell homogener Gemeinschaften, die durch bestimmte, teilweise gewollte Gemeinsamkeiten als einzigartig gekennzeichnet sind – und sei es durch ein bestimmtes Bildungs-, Gehalts- oder Lebensniveau, ja selbst durch Schuluniformen. Stefan Lüddemann spricht in der NOZ von einer Art Individualismus der Gemeinschaften, von denen jede anders sein will. Der Konflikt dieser beiden Kulturalisierungsregimes, die in einer widersprüchlichen Konstellation von Öffnung und Schließung münden, dürfte den künftigen „Kulturkampf“ maßgeblich beeinflussen, wenn nicht gar dominieren.
Mit einem extranationalen Blick differenziert Katrin Kruse in der NZZ auch die Kulturalisierung des Lebensstils als zweifachen Kulturkampf. Einerseits wolle man sich selbst entfalten, was sicherlich auch ein Freiheitsmodell bedeute. Hier sei es egal, was die anderen sagen. Andererseits müsse die Selbstverwirklichung nach außen dargestellt werden, dort kämen soziale Erwartungen dazu: Das Statusinteresse der neuen Mittelklasse ist ja nicht verschwunden. Idealerweise passten die zwei Ebenen der Selbstentfaltung und des Erfolghabenwollens zueinander.
„Sie können das Subjekt aber auch in zwei verschiedene Richtungen treiben. Das macht die Problematik, aber auch die Dynamik aus. Es hält das Subjekt am Laufen, weil es zwischen diesen zwei Richtungen pendelt.“
6 Der Themenkreis „‚differenzieller Liberalismus‘ als Ausdruck des neuen ‚Politischen‘“.
Die interessanteste Anmerkung zu diesem Komplex ist anonym auf Amazon zu finden: „Wie der neue Gesellschaftsvertrag im Kulturkapitalismus aussehen muss, steht nicht in diesem Buch. Aber wer die Analysen und Thesen von Andreas Reckwitz aufmerksam liest, weiß danach wenigstens, wo er mögliche Antworten suchen muss. Sicher nicht in den Parteiprogrammen der bisherigen Volksparteien … Ob es überhaupt möglich sein wird, das spätmoderne Subjekt für ein Zugehörigkeitsgefühl zu gewinnen, wird sich zeigen.“ Damit ist der wichtigste politische Diskussionspunkt angerissen: Gesellschaftsvertrag oder auch „Zugehörigkeitsgefühl“ (gleichwohl beides nicht identisch ist).
Denn der Staat sei immer weniger Garant für die Erhaltung des Gemeinwohls: „Angepasst an die Konsumbedürfnisse der Bürger, versteht sich der spätmoderne Staat als Einrichtung der Ermöglichung privaten Konsums und weniger der Verfolgung gesamtgesellschaftlicher Ziele. (S. 435) Die gesellschaftspolitische Herausforderung für die Zukunft sieht Reckwitz unter anderem darin, innerhalb einer Gesellschaft der Singularitäten wieder etwas zu rekonstituieren, das – zumindest provisorisch – allgemein anerkannt wird. Ebenso wichtig erscheint „angesichts der Parzellierung von medialen Teilöffentlichkeiten die Frage nach einer Rekonstitution allgemeiner Öffentlichkeit…, in denen Subjekte aus den unterschiedlichen Klassen und Milieus der Gesellschaft aufeinandertreffen“ (S. 440).
Für die Milieus, die diesen Prozess tragen, ergeben sich neue Freiheits- und Befriedigungsgewinne ebenso wie man angesichts der neuen Polarisierungen, des Spiels der Besonderheiten auf individueller und kollektiver Ebene eine Krise des Allgemeinen ausmachen muss: Das Strukturprinzip der Besonderung lässt eben dieses Allgemeine als das verbindende Element zwischen allen, auch das Gemeinwohl ins Hintertreffen geraten. Zu fragen ist also, ob es um die Freiheit von „Milieus“, von bestenfalls einem Drittel geht, oder um die Freiheit der vielen, der steuererwirtschaftenden Mehrheit?
Zwar weist Reckwitz explizit auf die gesamtgesellschaftlichen und gesamtstaatlichen Auswirkungen seiner Singularitäten und die dadurch hervorgerufenen Konflikte hin und erkennt Krisen der Anerkennung, der Selbstverwirklichung und des Politischen, wozu Kulturkonflikte, religiöser Fundamentalismus, ja insgesamt eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft gehörten. Auf die verweist drastisch auch Götz Kubitschek mit einer Kritik am Bundesverfassungsgericht, das in seiner neueren Rechtsprechung ein atomistisches, die Existenz eines Volkes leugnendes Menschenbild entwickle. Damit würde sich Karlsruhe auf juristischer Ebene einer seit Jahrzehnten herrschenden Politik anpassen, deren wesentliches Kennzeichen es sei, die Rechte des einzelnen gegen die Rechte der Gemeinschaft künstlich in Stellung zu bringen, was am Ende zu einer Auflösung aller Strukturen und Institutionen führt, in denen der Mensch Halt finden konnte (Ehe, Familie, Stamm, Volk usw.).
Allerdings macht sich Reckwitz die Antwort – wie alle Idealisten – sehr leicht, viel zu leicht, wenn er sie in eine unbestimmte erdachte Zukunft verlagert und fragt, ob die Gesellschaft der Singularitäten überhaupt noch ein Teil der Moderne oder ob sie nicht vielmehr unterwegs zu etwas ganz anderem ist, nämlich einer „nachmodernen Formation“. Einen Gegenpol zu bspw. Fukuyama einnehmend, ist für ihn die Moderne keine Universalie, sondern selbst durch und durch geschichtlich; sie habe nicht nur eine Entstehungs- und Verlaufsgeschichte, sondern sie wird irgendwann auch eine Geschichte des Verschwindens und der Transformation in andere, ihr nachfolgende Gesellschaftsformationen haben.
Übrig bleiben der Eindruck, dass die einen die anderen nicht verstehen können, ja wollen; und die Negierung, dass „diversity“ – und die Toleranz dafür – nicht ohne Individualismus und Differenzierung zu haben ist, kurz dass man keine Pluralität predigen, aber Singularität leben kann. Das ist mehr als ein Ausdruck der Schizophrenie der westlichen Rationalität. Es ist der Ausdruck der Krise des Allgemeinen im Politischen, der Verlust des Vertrauens in die Volksparteien, der sich geringstenfalls als Kulturnationalismus und schlimmstenfalls als Fundamentalismus äußert, ja als Kritik am westlichen Universalismus, der die eigenen Werte als weltweit gültig und richtig unterstellt.
Reckwitz macht dafür einen Liberalismus verantwortlich, der in Wirtschaft und Politik auf Deregulierung setzt und in der Gesellschaftspolitik die Identitätsrechte sämtlicher Minderheiten stärkt, Kultur aber gleichzeitig als Ressource der globalen Wettbewerbsfähigkeit instrumentalisiert. Von allen geschlossenen Gemeinschaften, und das sind Minderheiten in der Regel, werden die Identitätsangebote dankbar aufgegriffen und dogmatisch interpretiert. Und wenn nun bestimmte Minderheiten aufgrund kultureller Ungleichheit zugleich auch Verlierer sind, fänden die sich mehr und mehr bei „Populisten“ wieder und vice versa.
Ergo breiteten sich Parteien an den Rändern aus, die jene ansprechen, die im knallharten Rennen um Aufmerksamkeit nicht mithalten können – und die sich in den etablierten Parteien nicht mehr zu Hause fühlen, weil diese sich ihrerseits mehr und mehr für Randgruppen interessieren. Sexuellen, konfessionellen, ethnischen Minderheiten ist die Aufmerksamkeit auch der etablierten Parteien sicher. Die Vielen, die sich ihnen bislang anvertrauten, finden sich und ihre Anliegen nicht mehr angemessen vertreten.
Wohin diese Krise des Allgemeinen oder auch der Repräsentanz führt, schreibt Reckwitz, ist alles andere als ausgemacht. Das stimmt und mag für die einen beängstigend, für die anderen hoffnungsfroh anmuten. Eine ganz besondere Illustration fügte dieser Krisendiskussion das Koalitionshickhack nach dem 24. September 2017 zu. Felsmann schreibt lapidar:
„Wer die hier vorliegende Charakterisierung einer neuen Mittelschicht, die deutlich wahrnehmbar den öffentlichen Diskurs hierzulande bestimmt, ernst nimmt, dem muss Jamaika geradezu als logische Konstellation erscheinen.“

Koalitionspoker 2017. Quelle: https://image.stern.de/7638230/16x9-940-529/1e39ffcb6e9ed80b17307c7566e549a7/mW/jamaika.jpg
Für Reckwitz setzt gerade ein Rechtspopulismus auch auf das Register des Besonderen, in dem er etwa das eigene Volk und die Zugehörigkeit zu einer Nation betont, kehre dabei aber gleichzeitig die Ideale des Liberalismus der neuen Mittelklasse um, indem er auf Schließung und Regulierung plädiere, zwischen innen und außen trenne, das Eigene gegenüber dem Fremden betone, wo sie für Globalisierung, Öffnung der Märkte und Identitäten stehe. Er erkennt das durchaus richtig als Reaktion auf Entwertungstendenzen: Durch die kulturelle Entwertung und Kränkungserfahrung gerate die alte Mittelklasse gegenüber der neuen gebildeten kosmopolitischen Schicht in die Defensive und befürchte, nicht mehr mithalten zu können, woraus durchaus politische Sprengkraft erwachsen könne.
Es sei eine Trauer um das Verlorene, das die Ideologie des Rechtspopulismus bediene, schließt der Autor. Das aber ist zu simpel. Denn die Ausbreitung der Singularitätskultur macht vor keiner Politik halt, allerdings weniger auf dem Markt konkurrierender Parteienangebote, sondern z.B. in Spannungsfeld zwischen urbanen und ländlichen Räumen (Metropolen und Provinz), auf dem Gebiet neuer gesellschaftlicher Phänomene wie dem religiösen Fundamentalismus oder gar der Gewalt-Fokussierung mittels gezielter Terrorakte.
Vogel verweist weiterhin darauf, dass die von Reckwitz beschriebene neue Mittelklasse der Kreativen und Akademiker, die nun den Takt in der Singularitätsgesellschaft angibt, doch offensichtlich durch und durch ein Staatsprodukt ist. Das staatliche Bildungssystem habe sie geprägt, sie leben von und in den Bildungsapparaten, sie ernähren sich von öffentlich finanzierten Projekten. Staatlich finanzierte Fördertöpfe treiben die „kulturellen Singularitätsmärkte“ an. Denn zum guten Leben, zum richtigen Wohnen und zum korrekten Essen gehört ja auch ein auskömmliches Einkommen. Die von Reckwitz unter der Überschrift „Die Politik des Besonderen“ verbuchten Schlagworte der „kulturorientierten Gouvernementalität“ sowie des „Singularitätsmanagements“ (S. 388ff.) klingen für ihn nach einigem Aufwand an Steuergeldern.
Zudem erkennt er, dass der Wohlfahrts- und Rechtsstaat heute immer stärker partikulare Bedürfnisse beachtet und bedient, ja dass Staatlichkeit heute sehr viel selektiver agiert als in der Vergangenheit. Das alles spräche dafür, dem Staat analytische Aufmerksamkeit zu schenken, wenn es um Prozesse der Singularisierung geht. Aber auch hier schätze Reckwitz die Schematisierung – der Staat erscheint als der Agent der Massenkultur, der Vereinheitlichung, des „doing generality“. Dabei gibt es gestern wie heute vermutlich keine erfolgreichere Institution der sozialen Logik des Besonderen und der Selektion als den modernen Staat und seine Institutionen und Behörden. Das zu erkennen, fiele aber der Soziologie insgesamt sehr schwer.
Differenzen begrenzen, sollte die Devise lauten, womit Reckwitz einen „regulativen Liberalismus“ meint. Ein Liberalismus, der die geschwächten staatlichen Institutionen als Stellvertreter des Allgemeinen wieder aufwertet und an den richtigen Stellen – etwa in der Plattformökonomie – Regeln setzt. Allgemein hält Reckwitz eine Arbeit an geteilten Normen und Gütern für notwendig, um dem irrationalen Sog der Singularisierung entgegenzuwirken. Die Beschreibungen dieses Liberalismus, zumal der Inhalte, die er leisten sollte, bleiben aber mehr als vage. Eine weitere von vielen verschenkten Potenzen des Textes, zumal Bernd Ulbrich in der Zeit inzwischen auch dieses ideologische System infrage stellt: „Ist der Liberalismus wirklich eine Lebensweise für alle oder doch bloß die Herrschaftsideologie einer globalisierten Klasse?“
Fazit
In seinem abschließenden Resümee kontrastiert Reckwitz das normative Ideal eines gesellschaftlichen Fortschritts, dass die klassische Moderne bis in die 70er Jahre geprägt hat, mit der neuen Gesellschaft der Singularitäten. Prägend seien nun die „kleinen Erzählungen“ des privaten Erfolges und guten Lebens, nicht mehr die „große Erzählung“ der alten (kapitalistischen) Fortschrittsgesellschaft. Maßgeblich ist nicht mehr die immer auf Zukunft rekurrierende Zeitperspektive der alten Fortschrittsgesellschaft, sondern in der Spätmoderne herrscht ein radikales Regime des Neuen, das „momentanistisch“ ist, also nicht an langfristigen Innovationen, gar Revolutionen orientiert, sondern an der Affektivität des Hier und Jetzt. Was in der Spätmoderne „Fortschritt“ ist, lässt sich weitaus weniger einfach beantworten als in früheren Zeiten: Fortschritt und Regression, Aufwertung und Entwertung verteilen sich ungleich zwischen konträren gesellschaftlichen Gruppen: zwischen Kreativen und Arbeitern, Einheimischen und Emigranten, Kosmopoliten und Sesshaften…
Kulturalisierung, Singularisierung und Affektivierung gehen in Reckwitz’ Ansatz Hand in Hand: Sie prägen eine soziale Logik des Besonderen aus, die im Kontrast zur rationalisierenden Logik des Allgemeinen steht. Beide zusammen bildeten die konstitutiven Strukturprinzipien einer Spätmoderne, in der sich das soziale Primat von der Logik des Allgemeinen zur Logik des Besonderen verschiebt. Wo Mittel zum Zweck stärker wertgeschätzt werden als die Zwecke selbst, herrscht nicht etwa keine, sondern eine andere Kultur, eben die Kultur des Technischen, Ingenieurhaften, Bürokratischen etc., zumal die (Un-)Kultur der Algorithmen.
Im Raum steht damit, ob diese Entwicklung tatsächlich so und vor allem unumkehrbar eintritt, inwieweit sie nicht nur akademisch, sondern vor allem in der Bevölkerung akzeptiert und willkommen geheißen wird und welche weiteren – vor allem sozialen – Auswirkungen sie zeitigt. Wenn Anerkennung nur noch diejenigen finden, die Einzigartiges produzieren, und Verlierer diejenigen sind, die langweilige Routinejobs haben; aber auch die Gewinner auf den Singularitätsmärkten sich in einer Krise der Selbstverwirklichung gefangen sehen, da die Selbstoptimierung ihre Kinder frisst, da Singualisierung alleine nicht glücklich macht. Schließlich die Krise des Politischen, das jede Steuerungsmächtigkeit, ja -fähigkeit eingebüßt hat und der Eigendynamik der Ökonomie, der Medientechnologie und die Kultur der Lebensstile Platz machen musste. Öffentlichkeit, Staat sowie Recht scheinen da nur noch etwas für notorische Melancholiker der Gesellschaftssteuerung zu sein.
Von Siegern im neuen „Klassenkampf der Mitte“ mag man da ebenso wenig sprechen wie vom Projekt Gesellschaftsgestaltung, das als gestrig daherkommt. Hierfür steht nach vielen hundert Seiten die Conclusio von Reckwitz:
„Die sozialen Asymmetrien und kulturellen Heterogenitäten, welche dieser Strukturwandel der Moderne potenziert, seine nichtplanbare Dynamik von Valorisierungen und Entwertungen, seine Freisetzung positiver und negativer Affekte lassen Vorstellungen einer rationalen Ordnung, einer egalitären Gesellschaft, einer homogenen Kultur und einer balancierten Persönlichkeitsstruktur, wie sie manche noch hegen mögen, damit als das erscheinen, was sie sind: pure Nostalgie.“ (S. 442)
„Das Allgemeine hat immer weniger einen Ort innerhalb der Spätmoderne, auch die Frage nach dem, was Menschen gemeinsam haben, die Frage nach dem Allgemeinwohl, die Frage nach dem Universalen ist in diesem ständigen Wettbewerb um Einzigartigkeit, oder auch in dieser ständigen Profilierung von Gruppen besonders in den Hintergrund geraten. Wir müssen uns fragen, wo wir wieder Orte des Allgemeinen, auch der Frage des Allgemeinen schaffen können“, meint Reckwitz in einem DLF-Interview und bringt damit das wesentliche Dilemma seines Buchs auf den Punkt, das viele Rezensenten auch sahen.
Dieter Schnaas fragt sich etwa in der Wirtschaftswoche, „ob Reckwitz nicht zuweilen zum Opfer seinen eigenen Diagnose wird – und dem Zwang zur Überakzentuierung seiner originellen These erliegt. Sein soziologisches Raster ist für die Erschließung der mannigfaltigen Singularitäten etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Kunst und Wissenschaft zu grob. Es schließt einen historischen Zugang zur Wirklichkeit der Moderne nicht auf. Sondern verstellt ihn.“ Dirk Hohnsträter ergänzt auf Soziopolis, „wie die Sozial- und/oder Kulturwissenschaft/en der Logik des Besonderen gerecht werden können und wie ein sozusagen singularitätenadäquater Wissenschaftsstil – bei der Wissenserzeugung ebenso wie beim wissenschaftlichen Sprechen – eigentlich aussähe.“
Eine „Begriffsarchitektur mit immer wieder denselben Thesen“, bemängelt Thomas Steiner in der Badischen Zeitung.
„Wer so abstrakt bleibt, kann auch aus einer Tendenz umstandslos eine umfassende Gesellschaftstheorie machen: ‚In der Spätmoderne wird die soziale Logik der Singularisierungen, die zugleich eine der Kulturalisierung und der Affektintensivierung ist, zu einer für die gesamte Gesellschaft strukturbildenden Form.‘ So einfach ist das. Wenn man die einmal justierte Begrifflichkeit über alles stülpt.“
Engelmann macht darauf aufmerksam, dass desto mehr der beunruhigende Eindruck entstand, dass die Beharrungs- und Absicherungskräfte des Verallgemeinernden an Boden gewännen, je schneller sich das Neue und Innovative in Allgemeines zurückverwandelte. Aber
„der Staat ist laut Reckwitz nicht mehr die Einrichtung, welche gesamtgesellschaftliche Ziele aushandelt, definiert und umsetzt. Stattdessen ermögliche der Staat einen Rahmen, in dem Konsum stattfinden und damit auch Singularisierung hervorgebracht werden kann. Die schützende Funktion des Sozialstaates tritt dabei immer weiter zurück – denn das besondere Leben braucht die Unterstützung des Staates nicht mehr. Alle Krisen laufen – so die These – auf eine Krise des Allgemeinen hinaus. Statt einer Bewältigung von Krisen steuert die Gesellschaft jedoch in eine Dauerkrise, die selbst wiederum aufgrund der neuen normativen Maßstäbe in Bewegung gehalten werden muss.“
Richartz geht mit dem Autor wohl am schärfsten ins Gericht:
„Das Konzept der ‚Authentizität‘, das kritisch betrachtet als ein weiterer Modus der Selbstdarstellung gewertet werden könnte, welches eben Verschleierung und nicht Aufrichtigkeit zum Ziel hat, wäre eine Steilvorlage für eine tendenziell kritische Haltung gewesen. Reckwitz schlägt allerdings jede kritische Autorendynamik aus, er will im Elfenbeinturm der Soziologie ankommen.“

Vereinzelung. Quelle: https://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.968680/860x860?v=1528252767000&method=resize&cropRatios=0:0-Zoom-www
Den letzten Satz würde ich sogar noch steigern: Reckwitz hat eine subjektivistische Theorie der Vereinzelung vorgelegt, die in letzter Konsequenz bedeutet, dass wir statt Soziologie künftig eine Individuologie haben werden, in der jeder alles sagen kann und damit gleich richtig oder falsch liegt. Dass so ein anmaßender Text just 130 Jahre nach Ferdinand Tönnies „Gemeinschaft und Gesellschaft“ erscheint, das als erstes sozialwissenschaftliches Grundlagenwerk Deutschlands gilt und untersuchte, wie aus den traditionellen Kleinst-Einheiten von Familie, Glaubensgemeinde oder Dorf der Zusammenhalt in dem entsteht, was man als „moderne Gesellschaft“ begreifen kann, ist da ein zufälliger Lapsus, der die Destruktivität der entworfenen Theorie noch unterstreicht.