langweiliges, blutleeres, pubertäres Geschwätz
22. März 2021 von Thomas Hartung
Meine letzte Rezension liegt schon ein Weilchen zurück, aber ich fand zwischendurch auch kein Buch, das mich zu einem längeren Text herausgefordert hätte. Das änderte sich nach der Krankenbettlektüre eines 399-Seiten-Romans, der in den Feuilletons 2019 nachgerade enthusiastisch besprochen wurde: Sally Rooneys „Gespräche mit Freunden“ (orig. „Conversations with Friends“ 2017) – das Manuskript der damals vollkommen unbekannten irischen Autorin, Jahrgang 1991, war lukrativ versteigert worden. „Die wichtigste Stimme der Millennialliteratur“ hat der Independent sie genannt. Für ihr Erstlingswerk wurde Rooney 2017 von der Sunday Times als „Young Writer of the Year“ ausgezeichnet. Man kann noch erwähnen, dass sie mit 22 Jahren Europameisterin im Debattierwettbewerb der europäischen Universitäten, dem EUDC, wurde.
„Gnadenlos intelligent“ jubelt die FAS, die Generation der Millenials würde darin „hellsichtig seziert“ (FAZ), die Sprache sei „schnörkellos“ und „mondän“ (FAZ), ja „warmherzig“ (DLF), die Dialoge gar „atemberaubend“ (FAZ), kurz der ganze Hype „in diesem Fall glücklicherweise komplett berechtigt“ (Süddeutsche). Von gelegentlicher Einzelkritik abgesehen, fand ich nicht einen Verriss. Soso. Nach meiner Lektüre allerdings war ich ordentlich durchgeärgert. Weniger wegen der vertanen Lebenszeit (hätte ich halt ein anderes Buch gelesen), sondern eher der geradezu unheimlichen Kongruenz von schlechter Literatur mit bester Kritik: wieso werden selbst abartige literarische Fehler derart unisono positiviert und ins Gewollte, ja Gekonnte uminterpretiert, wie das etwa der Spiegel mit dem Terminus „geniale Vagheit“ praktiziert?
Was ich las, war, knappstmöglich bilanziert, langweiliges, blutleeres, pubertäres Geschwätz. Dabei, und die Plattitüde muss jetzt sein, entsprach die Autorin perfekt meiner Imagination der Protagonistin: Ein langweilig-schnippisches „Wasch-mich-aber-mach-nicht-nass“-Püppchen mit Emaille-Wangen, ausdruckslosen Augen, zu großer Nase, dafür sehr sinnlichem Mund und kleinen Brüsten, gekleidet in eine unscheinbare Bluse und einen Faltenrock, der einen Blick auf ihre etwas zu strammen Waden freigab. Die NZZ nannte sie „ein bisschen linkisch“, obwohl sie genau diesen Eindruck ihrer Hauptfigur machte: Den einer Literaturstudentin mit dem Drang zu geradezu zwanghafter Selbstbeobachtung und –beschreibung, zwischen Selbstzweifel und Selbststilisierung, die mehr Geist als Körper ist und zu ihren eigenen Gefühlen keinen Zugang findet. „Ich war nicht, wer ich vorgab zu sein“, bringt die Ich-Erzählerin das selbsterkannte Dilemma auf den Punkt.
Sie heißt Frances und war mit ihrer besten Freundin Bobbi während der Schulzeit ein Paar – das Switchen zwischen verschiedenen sexuellen Identitäten wird nicht weiter thematisiert, sondern ungeachtet aller psychischen Folgen als selbstverständlich genommen. Mittlerweile studieren beide am prestigeträchtigen Trinity College in Dublin und treten als Duo bei Spoken-Word-Events auf – Poetry Slam, sagt man hierzulande. Frances schreibt alle Texte, Bobbi ist die bessere Performerin.
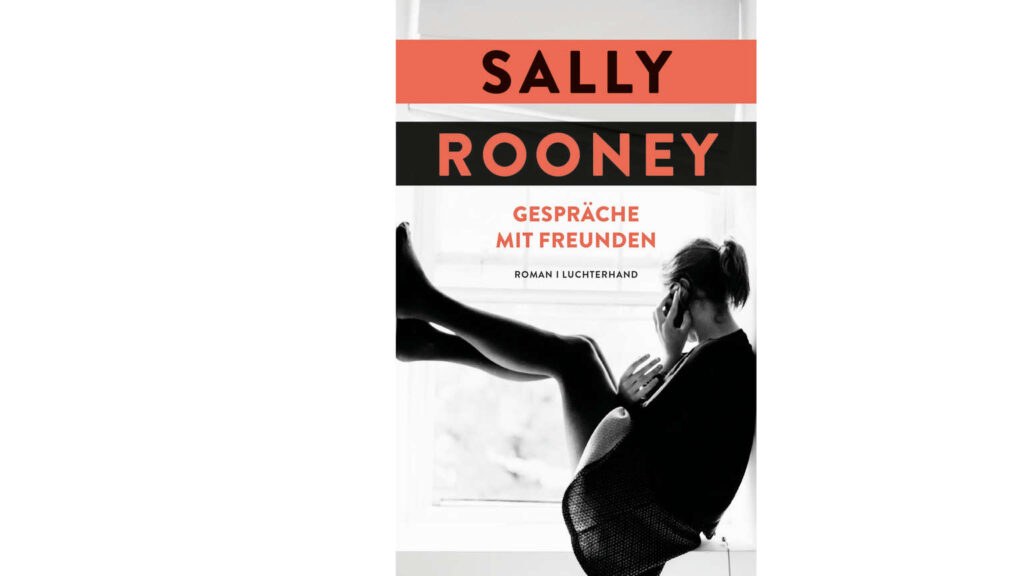
Als die beiden eines Abends die 37-jährige Kulturjournalistin Melissa und später ihren jüngeren, erfolgloseren Mann Nick, einen mittelmäßigen Aktor kennenlernen, überträgt sich diese Aufgabenteilung auch auf ihr Liebesleben. Während Bobbi direkt mit Melissa zu flirten beginnt, ist Frances‘ erster Schritt bei Nick, ihm eine Mail zu schreiben. Die restliche Handlung verliert sich in minimalistischer, unterkühlter Sprache an unterschiedlichen Schauplätzen und mittels diverser Medien wie Dialogen, Mails, Chats im komplizierten Beziehungsgeflecht aus Zuneigung, Abneigung, heimlichen und später offenen Affären zwischen diesen vier Figuren.
„Marxismus als Stilrepertoire“
Das Buch kreist dabei um zwei Dinge. Zum einen um Geld, Macht und den Kapitalismus. Auf dem Weg zu Melissas Haus erklärt Bobbi ihrer neuen Bekannten: „Ich bin lesbisch, und Frances ist Kommunistin“. Während der ersten richtigen, postkoitalen Unterhaltung zwischen Frances und Nick heißt es: „Beim Abendessen tauschten wir ein paar Details aus unserem Leben aus. Ich erklärte ihm, dass ich den Kapitalismus zerstören wolle und dass ich Männlichkeit persönlich als unterdrückend empfand. Nick sagte, er sei ,grundsätzlich‘ ein Marxist, und er wolle nicht, dass ich ihn verurteile, weil er ein Haus besaß.“ An einer anderen Stelle sagt Frances „Ferienhäuser egal wo zu haben sollte gesetzlich verboten sein.“
„Bobbi hatte eine Art an sich, mit der sie überall dazugehörte“, beschreibt Frances. „Obwohl sie sagte, sie hasse die Reichen, war ihre Familie reich, und andere wohlhabende Menschen erkannten sie als eine der ihren an. Ihre radikale politische Einstellung betrachteten sie als so etwas wie bourgeoise Selbstkritik, nichts allzu Ernsthaftes, und sprachen mit ihr über Restaurants oder wo man in Rom wohnte. Ich fühlte mich in diesen Situationen fehl am Platz, unwissend und bitter, hatte aber auch Angst davor, als halbwegs armer Mensch und Kommunistin identifiziert zu werden.“
Scheinbar alles, was Frances (und auch Bobbi) tun, tun sie in einer ständigen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Umständen und in gewisser Weise auch mit sich selbst, filtern es durch Klassen- und Geschlechterverhältnisse, geprägt von Zukunftsängsten und echter materieller Not: Eine Zeit lang lebt Frances von Toastbrot. Denn Frances‘ alkoholkranker Vater kann seiner Tochter monatelang keinen Unterhalt überweisen, auf den die Studentin dringend angewiesen ist. Trotzdem strebt Frances keine Karriere an.

Der Anfang Zwanzigjährigen erscheint eine Festanstellung, ja Lohnarbeit überhaupt weder aussichtsreich noch erstrebenswert. Lustlos absolviert sie zwar ein unbezahltes Praktikum in einer Dubliner Literaturagentur. Ihren prekären Lebensstil hat sie jedoch längst zum Programm erhoben. „Ich hatte verschiedene Niedriglohnjobs in den vergangenen Sommerferien und ich ging davon aus, dass es nach meinem Abschluss so weitergehen würde. Auch wenn ich wusste, dass ich irgendwann eine Vollzeitstelle antreten musste, phantasierte ich garantiert nie von einer strahlenden Zukunft, in der ich dafür bezahlt wurde, eine wirtschaftlich relevante Rolle einzunehmen.“
Einmal erklärt sie wie fürs Protokoll, „dass mein Desinteresse an Reichtum ideologisch gesund war. Ich hatte nachgesehen, wie hoch das durchschnittliche Jahreseinkommen wäre, wenn das Weltbruttosozialprodukt gerecht auf alle verteilt würde, und laut Wikipedia läge es bei 16 100 Dollar. Ich sah keinen Grund, weder politisch noch finanziell, warum ich je mehr als diese Summe verdienen sollte.“ Das hält sie jedoch nicht davon ab, sich ins französische Sommerhaus von Melissa und Nick einladen zu lassen und Wein und Lamm zu genießen.
Klassenunterschiede mobilisieren keine Wut, münden noch nicht einmal in Konsumkritik oder werden sonstwie hinterfragt, sondern einfach nur vage als „schlecht“ beschrieben. Selbstgenügsamkeit, provozierte Bescheidenheit oder passive Duldungsstarre vor einem als monströs empfundenen sozialen Moloch: Nichts genaues weiß man nicht. „Marxismus erscheint so als ein Stilrepertoire, ein Slang unter vielen, dessen sich Rooneys polyglotte Figuren je nach Bedarf bedienen“, erkennt Anna Pilarczyk im Spiegel.
„das Recht, niemanden zu lieben“
Zum anderen geht es um Krankheit, Liebe, Freundschaft, die vielen Abstufungen dazwischen, und um Gefühle, die so stark sind, dass die Ich-Erzählerin sie nur ertragen kann, indem sie sich selbst physische Schmerzen zufügt und ritzt, womit sich der Kreis zur Krankheit schließt: sie leidet, wie später festgestellt wird, unter Endometriose, was fatal heilkundliche Befunde unterstützt, wonach Gefühle, wenn sie nicht externalisiert werden, sich nach innen richten.
Denn Frances tut alles dafür, um von ihrer Umgebung für cool, souverän und unabhängig gehalten zu werden: Gefühle unterdrücken, lügen, Chatnachrichten erst schreiben und dann doch wieder löschen… als sei sie in eine ständige Selbstbefragung verstrickt. Wie wirke ich auf andere, wie komme ich an, bin ich gut genug? Wichtig ist eine gewisse Coolness, die nur aufrechtzuerhalten ist, wenn man Distanz wahrt, zu anderen, aber auch zu sich selbst. So lebt sie ihr Leben nicht, sondern kuratiert es. Aber wo wird es ausgestellt, wer soll es sehen?
Denn gleichzeitig dreht sich bei ihr alles um das eigene Ego, die eigene Befindlichkeit. Ein gefährlicher Spagat, der verletzbar macht. Sich dem zu entziehen, gelingt halbherzig, indem sie möglichst wenige Gefühle zeigt, auch wenn sie sie in den Sozialen Medien oft inflationär zur Schau stellt, aber in der Realität vorsichtig, ja misstrauisch ist: „Als Feministin habe ich das Recht, niemanden zu lieben.“ Sie ist trotz der fast symbiotischen Beziehung zu Bobby einsam – als sie Sexbilder eines US-Studenten erhält, ist sie völlig überfordert und findet außer der Löschtaste keine Bewältigung: „Ich erzählte niemandem davon, es gab niemanden, dem ich davon hätte erzählen können.“ So verhält es sich auch in der Liebesbeziehung, die Frances mit Nick eingeht, zunächst im Geheimen, dann mehr oder weniger geduldet von Melissa.

Also seziert sie neben den anderen und der Welt vor allem sich selbst, auch im Spiegel, auch auf Fotos. Das geht soweit, dass sie oft genug ihren Gesichtsausdruck ahnt und beschreibt, ohne ihn zu sehen. Was sie erlebt, ist oft genug begleitet von einem Bewusstsein dafür, wie man es später beschreiben könnte, und wenn etwas Unangenehmes passiert, denkt Frances „sogar darüber nach, wie lustig ich in einer E-Mail darüberschreiben könnte“.
Dieser Zwang, verbunden mit ihrer ärmlichen Herkunft, macht sie oft blind für die Nöte und Empfindlichkeiten der anderen – mit manchmal verheerenden Folgen. Ihre Liebe zu Nick trägt das Korsett eines prononcierten Machtanspruchs: Glück heißt für sie, „die volle Kontrolle“ in der Beziehung zu haben. „Ich könnte gehen, dachte ich, und darüber nachzudenken fühlte sich gut an, als hätte ich wieder die Kontrolle über mein Leben.“
Dabei wird permanent die Ambivalenz zwischen ihrem eigenen Innenleben und ihrer Außenwirkung thematisiert: „Ich war aufgeregt, bereit für die Herausforderung, in die Wohnung einer Fremden zu gehen, und legte mir schon ein paar Mienen und Komplimente zurecht, um charmant zu wirken.“ Zu wirken, wohlbemerkt, nicht zu sein. Reflektieren statt leben. Diese Kombination aus Unsicherheit, Verletzlichkeit und Narzissmus ist nicht nur die härteste Waffe, die Frances im Umgang mit ihrem Umfeld hat, sondern eben auch ihre offene Flanke.
Ihre Verfasstheit gipfelt in religiösem Sendungsbewusstsein: „Jesus wollte immer der bessere Mensch sein, ich auch.“ „Die größte Grausamkeit für Rooneys Generation, zu der ich auch gehöre, ist aber, dass wir von der Welt geliebt werden wollen, von der wir vorgeben, sie zu hassen“, hat die junge Kritikerin Madeleine Schwarz Rooneys Paradox in der New York Review of Books zusammengefasst.
„ihr Inneres zu verschleiern“
Dabei geizt Rooney geradezu mit Details, jede Information, die ein zu klares Bild von einer Figur geben könnte, spart sie aus. Nick wird schnöde mit den Worten „Er hatte ein großes, schönes Gesicht“ skizziert. Konterkariert wird diese figürliche Detailarmut von funktionalem Detailreichtum, wenn es etwa vor einem Lyrikevent heißt: „Wir hatten eine Flasche Weißwein reingeschmuggelt, die wir uns auf dem Klo teilten.“ Dass Plastebecher beim Vertilgen der Konterbande zum Einsatz kamen, versteht sich von selbst.
Selbst popkulturelle Verweise hält Rooney abstrakt. So heißt es an einer Stelle, dass sich Nick und Frances „einen iranischen Film über Vampire“ ansehen. Als Ausweis dafür, dass die beiden einen anspruchsvollen Filmgeschmack haben, reicht das völlig. Wer es weiß, denkt sich hinzu, dass es sich um „A Girl Walks Home Alone At Night“ von Ana Lily Amirpour handeln muss. Wer es nicht weiß, hat an Bedeutung aber auch nichts verpasst. Diese Ambiguität aus einerseits pseudointellektuellem Gebaren, das andererseits gar nichts bedeutet, macht den Roman in Gänze so belanglos: Nicht umsonst fragt sich Frances, „warum ich mich nicht für mein eigenes Leben interessierte“.

Rooneys lakonische Dialoge drehen sich permanent um das Offensichtliche und zugleich mitschwingende Verborgene, die Figuren sind nicht dümmer als die Autorin. Tilman Spreckelsen mutmaßt in der FAZ, dass das „nicht nur an den Lügen und Heimlichkeiten“ liege, an dem vielen, das angedeutet und falsch oder gar nicht verstanden wird, an dem, was auf der Zunge liegt und dann doch nicht gesagt wird oder den intensiv empfundenen, aber höchst wandelbaren Emotionen. „Es liegt auch nicht nur an den Techniken, die gerade die älteren Protagonisten ausgebildet haben, ihr Inneres zu verschleiern, was wiederum auf den Argwohn der anderen trifft.“ Wer eine moderne Ausprägung des Spengler’schen „Ibsen-Weibs“ sucht – hier wird er fündig.
Der Titel lässt zu Recht durchblicken, dass es sich um ein schier endloses Palaver handelt, das sich noch dazu in Textnachrichten und Mails fortsetzt, die als Frances’ Gedächtnis erscheinen: Hier geht sie mit der praktischen Suchfunktion vergangenen „Gesprächen“ nach, die Melancholie beim Lesen alter Briefe findet ihre zeitgemäße Fortsetzung. Denn wenn unsere Gegenwart immer komplexer und jede Information darin digital jederzeit verfügbar wird, lässt sich die Welt – auch erzählerisch – nur durch radikale Selektion bewältigen.
Bei dieser Selektion kann man als Autorin subjektiv vorgehen oder die Datenmenge per Suchalgorithmus eingrenzen, so wie Frances es anhand ihrer Chats mit Bobbi beschreibt: „Diesmal lud ich mir unsere Unterhaltungen als riesige Textdatei mit Zeitstempeln herunter. Ich sagte mir, sie sei zu groß, um sie von Anfang bis Ende zu lesen, und sie hatte auch keine durchgehende erzählerische Form, also beschloss ich, sie zu lesen, indem ich nach bestimmten Wörtern oder Phrasen suchte und um sie herum las.“ Miriam Zeh orakelt im DLF: „Die Autorin hätte vermutlich nichts dagegen, wenn ihre Romane auf dieselbe Weise gelesen würden.“
Auch psychologisch verblüfft der Roman durchs Ungefähre. Immer wieder werfen die Figuren mit ihrem Verhalten Rätsel auf, irritieren durch plötzliche Tränen oder zynische Ausbrüche. Ihre Figuren entstammen einem bestimmten Milieu, einer weißen und überdurchschnittlich gebildeten, urbanen Mittelschicht. Hier – und nur hier – diskutiert man über den kapitalistischen Nutzen von Monogamie, über das kommunistische Manifest und über Gilles Deleuze. „Nervig-pseudointellektuelles Gelaber“ stöhnt selbst Nina Apin in der taz, aber meint zugleich: „Die Sexszenen sind ziemlich gut. Und das ist wirklich selten.“ Entweder hat sie einen anderen Text gelesen, oder ich will mir nicht ausmalen, wie ihr Sexleben aussieht.
„Ich habe keine Agenda“
„Über weite Strecken scheint Sally Rooney selbst nicht zu wissen, wohin sie sich als nächstes schreibt. Ein heimliches Treffen von Nick und Frances reiht sich ans nächste“, erkennt Zeh. Erzählstränge versanden mit offenen Enden, Konsequenzen werden nicht ausgesprochen und Fragen nicht gestellt. Als „Geschichte ohne Fazit“, die zu peinlich sei, um erzählt zu werden, bezeichnet Frances einmal einen ihrer Tage und fasst damit Rooneys gesamten Roman zusammen: „eine Absage an die vollständige Erzählbarkeit einer zwischenmenschlichen Beziehung und eine Absage an den Autor als Allmacht.“ Dazwischengetupft immer mal ein Bild, das ihre durchaus vorhandenen Ansätze erkennen lasst wie „Im Bett falteten wir uns wie Origami ineinander“ oder „Die Luft schien hilflos auf den Straßen gefangen“. Aber auch hier Begrenztheit und Passivität.
Der Übersetzung von Zoë Beck gelinge es, dabei immer dieselbe Texttemperatur zu halten, meint Meredith Haaf in der Süddeutschen. Es stecke ein „austrainierter“ und doch „warmer, lebendiger Intellekt“ hinter dem Text. Aha. „Easy reads“ nennt man im Englischen süffige, voraussetzungsarme Lektüren, bei denen man rasch von einer Seite zur nächsten blättert – das trifft es besser. Einen „Entwicklungsroman“, den Anne Kohlick im DLF gelesen haben will, konnte ich gleich gar nicht entdecken. Denn der Text – der Mann bleibt bei seiner Frau, die Liebhaberin vielleicht ratlos-verletzt, dennoch solo – steuert auf ein offenes Ende hin: „Ist es möglich, dass wir ein Alternativmodell entwickeln, wie wir einander lieben?“
Da wird eine Beziehung zer- und die Emotionalität einer naiven Kind-Frau nachhaltig verstört, aber all das plätscherte so dahin, hätte auch anders verlaufen können und wird in seinen Folgen eher niedlich ausfallen – oder gewaltig. Weder die Erzählerin noch die Autorin kümmerts: „Ich habe keine Agenda. In meinem Roman bin ich nicht daran interessiert, über die Dinge zu urteilen – auch nicht über Dinge, die mir sehr am Herzen liegen … Ich bin nur daran interessiert, es zu beobachten, und wenn ich es sehe, werde ich darüberschreiben“, sagte sie der FAZ. Angela Schade befand in der NZZ: „Das kalte Feuer, das durch diesen Roman irrlichtert, hat die Figuren zwar nicht verzehrt; aber es lässt sie als gebrannte Kinder zurück.“

Mich frappierte daneben die Menge an Meta-Text, die Rooney und ihr Roman produzierten: neben Essays, Autorenporträts und Rezensionen auch Instagram-Posts von Prominenten wie Sarah Jessica Parker. Prompt musste auch Haaf die Frage aufwerfen, „ob das nicht einfach Wohlfühlliteratur für ein arriviertes Publikum ist. Und ob man da nicht einfach nur einer sehr gut gemachten intellektuell-literarischen Hochstapelei aufgesessen ist.“ Sie traute sich offenbar nicht, Ja zu antworten. Ich schon. Was sich vielleicht aufmachte, die Formen und Bedingungen ihres eigenen Begehrens und das der anderen zu reflektieren und den Versuch zu machen, sich diesen Prägungen zu entziehen, endet im literarischen Nirvana.
Es gab mal Zeiten, da galten irische Autoren als Maß aller Dinge. Zu den irischen Trägern des Literaturnobelpreises zählen William Butler Yeats (1923), George Bernard Shaw (1925), Samuel Beckett (1969) und Seamus Heaney (1995). Diese Zeiten, muss man angesichts von Rooney konstatieren, sind dahin. Unwiederbringlich. Das für mich positivste an der Causa folgt zum Schluss: Mit ihrem zweiten Roman „Normal People“ stach Rooney 2019 in Großbritannien Michelle Obamas Autobiografie als „Buch des Jahres“ aus. Was wiederum viel über die Qualität des Obama-Textes aussagt. Oder die der Übersetzung. Vielleicht stammte die ja von einem unsensiblen, alten, weißen Mann, der sie gar nicht hätte verfertigen dürfen…