„abgrundtiefe Bildungsdefizite“
9. Oktober 2021 von Thomas Hartung
Liebe Freunde,
Von Straßen über Apotheken und Vögeln bis hin zu Konsumgütern wie Keksen ist der Bürger inzwi-schen Umbenennungsärger gewohnt. Doch dass Dresdens Museen jetzt auch Alte Meister verunstalten, tut weder der Kultur noch dem sozialen Frieden gut und lässt den Ärger in Wut umschlagen – schrieb ich in meiner aktuellen Tumult-Kolumne, die am Freitag (08.10.21) online ging. Doch da sowohl das Feuilleton der Sächsischen Zeitung als auch SPD-Grande Wolfgang Thierse in derselben noch Anmerkungen tätigten, hier mein aktualisierter Text dazu.

Für Marion Ackermann muss in der alten deutschen Redewendung „Aller guten Dinge sind drei“ das „gute“ durch „schlechte“ ersetzt werden. Die Göttinger Kunsthistorikerin, seit 2016 Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden SKD, hat seitdem drei veritable Skandale hingelegt. Zuerst verbannte sie DDR-Kunst ins Depot, was den „Dresdner Bilderstreit“, einen Aufstand des Kulturbürgertums, nach sich zog. Dann ließ sie sich von Berliner Clangangstern elf unschätzbare und bis heute verschwundene Kleinode aus dem Grünen Gewölbe buchstäblich unterm Hintern wegstibitzen. Die Sicherheitseinrichtungen hätten doch funktioniert, log sie, und freute sich später: Die Räuber hätten doch gar nicht alles mitgenommen, es wäre ja immer noch was da. Und nun vergriff sie sich an teilweise jahrhundertealten, vertrauten Bezeichnungen für Kunstwerke.
Was war geschehen? Im Zeichen der „äußersten Sensibilisierung für Sprache“ wurden insgesamt 143 Exponate in Orwell‘scher Manier um- oder gleich ganz neubenannt, weil ihre Werktitel „rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe oder Inhalte“ aufwiesen: „Der effektivste Weg, Menschen zu zerstören, besteht darin, ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte zu leugnen und auszulöschen“, schrieb der Brite in „1984“. Aus „Zwerg“ wurde „kleinwüchsiger Mann“, aus „Knabe“ wurde „Junge“, aus „Zigeunermadonna“ wurde „Madonna mit stehendem Kind“, und aus „indischen Eingeborenen“ wurden einfach nur „Menschen“. Der Name des Gemäldes „Landschaft mit mohammedanischen Pilgern“ von Christoph Ludwig Agricola (ca. 1710) wurde beispielsweise in „Landschaft mit betenden Muslimen“ abgeändert. Vor allem die Tilgung von „Mohr“ und „Zigeuner“ fiel auf: Aus einer „Zigeunerin“ etwa wurde eine „Frau mit Kopftuch“. Ob es sich dabei um eine Katholikin im Petersdom oder eine Muslimin handelt, spielt offenbar keine Rolle mehr.
Bei elf Exponaten wurde der Titel nicht umgeändert, sondern durch Asterisken (Sternchen) unkenntlich gemacht. Die Statuette „Mohr mit der Smaragdstufe“ von Balthasar Permoser als Bildhauer und Johann Melchior Dinglinger als Goldschmied, eins der namhaftesten Kunstwerke überhaupt, wurde so etwa zum „**** mit Smaragdstufe“. Ackermanns Begründung in der Sächsischen Zeitung SZ liest sich absurd: Die Trägerfigur symbolisiere – aus europäischer Perspektive – in jedem stereotypen Detail vermeintliche „Andersartigkeit“: dunkle Hautfarbe, als „afrikanisch“ gelesene Physiognomie, Tätowierungen und Schmuckstücke, die wiederum als Repräsentationsformen indigener Kulturen Nordamerikas gedeutet wurden. Aus postkolonialer Sicht ist auch die Herkunft der Smaragdstufe aus kolumbianischen Smaragdminen, die während spanischer Eroberungskriege 1537 erschlossen wurden, problematisch.

Wer denkt, das war jetzt alles, irrt. Denn die – nunmehr bereits arg entzauberte – Smaragdstufe wird auf einem Schildpatt-Tablett dargeboten. Das Staunen über die Schönheit des Materials, so die Generaldirektorin, wird getrübt durch den Gedanken an das viel zu spät ratifizierte Artenschutzabkommen für Meeresschildkröten. „Offenbar hatte August der Starke seinerzeit vergessen zu unterschreiben“, ärgert sich Erik Lommatzsch auf achgut. Kurzum, in der Figur spiegele sich Ausbeutungsgeschichte: der von Menschen und der Natur. Da fällt fast gar nicht mehr ins Gewicht, wie sich ein schwarzer „People of Color“ fühlen muss, wenn er plötzlich nicht mehr benannt, sondern auf vier Symbole reduziert wird. Über 50.000 Bundesbürger tragen den Nachnamen „Mohr“. Auch der Spitzname von Karl Marx soll Mohr gewesen sein, in der DDR erschien der Jugendroman „Mohr und die Raben von London“. Wird der jetzt in „**** und die Raben von London” umbenannt? Mehr Sprach-, mehr Geschichtsklitterung war nie.
„da wird Bewusstsein geschaffen“
Ackermanns Pressesprecher Holger Liebs nennt das gegenüber der Süddeutschen Zeitung einen „didaktischen Ansatz, der die Historie des Begriffs nicht ausblendet, sondern sie im Gegenteil sichtbar macht; da wird Bewusstsein geschaffen“. Sie selbst verteidigte das Vorgehen in der SZ als „übliche Museumsarbeit“, es gehe nicht nur um Begriffe, die historisch bewusst abwertend benutzt wurden, sondern auch um den Sprachgebrauch einer Zeit, in den „unreflektiert Begriffe Eingang fanden, die heute als eindeutig rassistisch oder diskriminierend bewertet“ würden. „Um keine Menschen über die Reproduktion dieser Sprache zu verletzen, werden die Werktitel … sukzessive überarbeitet“; über dies bedürften sie, „je nach Forschungsstand, der wissenschaftlichen Kontextualisierung“, was neben der Vermeidung von Diskriminierung „der kunsthistorischen Begriffspräzisierung“ diene. Ja mehr noch: So könnten „künstlerische Interventionen und Neuproduktionen angeregt und gefördert werden. Wir könnten sagen, der monolithische Status des Objekts wird dadurch aufgebrochen, entmaterialisiert und wieder rematerialisiert.“ Das ist kein Witz.
Aufgedeckt hatte den Frevel der kulturpolitische Sprecher der sächsischen AfD-Landtagsfraktion Thomas Kirste MdL mit einer Kleinen Anfrage. „Allein der Nennung ‚Kopf eines Eskimos‘ Diskriminierung zu unterstellen und daraus ‚Kopf eines Inuit‘ zu machen, ist keine ‚kunsthistorische Begriffspräzisierung‘, wie die SKD behauptet, sondern schlichte Zeitgeistanbiederung, die das Fremde höher schätzt als das Eigene – und damit das Gegenteil dessen betreibt, was sie zu bezwecken vorgibt“, erregt sich der kunstpolitische AfD-Fraktionssprecher Baden-Württembergs, Dr. Rainer Balzer MdL: Ackermann hatte zuvor sechs Jahre das Kunstmuseum Stuttgart geleitet. Prompt warnte Balzer die baden-württembergische Museumslandschaft davor, dem abwegigen sächsischen Vorbild zu folgen. „Man stelle sich vor, Nicola Grassis ‚Hiob, von seinem Weib verspottet‘ in der Stuttgarter Staatsgalerie würde nun heißen ‚Hiob, von seiner Frau verspottet‘“.

Auch dass Werke überhaupt einer „kunsthistorischen Begriffspräzisierung“ bedürfen, ist eine ungeheuerliche Unterstellung, die alle Kunstinteressierten unten den Generalverdacht der Dummheit stellt – hier trifft ebenfalls das Gegenteil zu. Und geradezu unverfroren ist es zu behaupten, dass diese Praxis „eine übliche, seit Jahrhunderten in sehr vielen Museen in aller Welt stattfindende Praxis“ sei: Damit mutieren Orwells Phantasien langsam zu Tatsachenbeschreibungen. Die Anbiederung an den Zeitgeist wird besonders daran deutlich, dass das Kirste antwortende Dresdner Kunstministerium abwiegelte und auf Nachfrage von Bild sagte, dass es „eine solche Überprüfung weder veranlasst noch durchgeführt“ habe – der Schluss liegt mehr als nahe, dass Ackermann in vorauseilendem Gehorsam aktiv wurde.
Besonders perfide erscheint dabei das Eingeständnis, dass diese stille Tilgung in dem seit 1560 bestehende Museumsensemble bereits seit 2020 vollzogen wird. In diesem Jahr hatte sich die Initiative „DDekolonisieren“ in einem Offenen Brief an das Albertinum und die Staatlichen Kunstsammlungen gewandt und darin beklagt: „Die Ausstellungen setzen viel Wissen zu den geschichtlichen und kolonialen Hintergründen voraus, anstatt diese Kontexte direkt zu thematisieren und zu erläutern.“ Auch sei die Reproduktion von rassistischer Sprache und rassistischen Stereotypen „erschütternd und besorgniserregend“. Prompt heißt es seitens der Aktivisten, die von der linken und grünen Jugend unterstützt wurden: „Sie müssen Verantwortung übernehmen für die Kontextualisierung ihrer Ausstellungsstücke in einer kolonial geprägten Gesellschaft und für die zugehörige Bildungsarbeit.“
„reißerische Zuspitzungen“
Sich heute von Kunstwerken und Worten aus früheren Jahrhunderten beleidigt zu fühlen, sagt mehr über die Beleidigten als über die Kunstwerke und deren Benenner: „abgrundtiefe Bildungsdefizite – gepaart mit verbohrter Ideologie. Eine höchstgefährliche Kombination, wie die Geschichte lehrt“, erkennt der Ex-Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus, in Tichys Einblick TE. Wer einmal an den SKD tätig werden durfte, galt forthin als kunstpolitische Koryphäe, als Lordsiegelbewahrer höchster Kultur, als souveränes Bollwerk gegen den Zeitgeist, ja als Hüter manifester Beweise für die Existenz der Ewigkeit. Damit scheint es spätestens jetzt vorbei zu sein. Denn die zu Kandinsky promovierte Museumschefin entblödete sich nicht, parallel dazu eine „Antidiskriminierungs-AG“ zu etablieren, „in die so viele interne Mitarbeiter*innen wie möglich einschließlich externer thinkers of color eingebunden“ wurden. Auch das ist kein Witz.
Prompt ließen die Relativierungen des Vorgangs, den der DLF „Diskriminierungscheck“ nannte, nicht lange auf sich warten. Der Gesamtbestand aller bislang in der Datenbank der SKD erfassten Objekte beträgt über 1,48 Millionen – die Aktualisierungen entsprächen damit gerade 0,01 Prozent der katalogisierten Titel, hieß es eilfertig. Außerdem hinge die Bearbeitung von Werk- oder Objekttiteln damit zusammen, dass diese bis ins 19. Jahrhundert hinein nur selten von denen betitelt wurden, die sie geschaffen haben. Insofern würden sie in den allermeisten Fällen keinen vom Künstler vergebenen Originaltitel ausweisen. „Da herrschte nicht nur eine gewisse Willkür, sondern es wurden auch sachliche Fehler gemacht“, behauptet Sebastian Frenzel im Monopol-Magazin, ohne diese These zu belegen. Oder gilt neuerdings als sachlicher Fehler, sich damals aus dem damaligen Sprachschatz bedient und nicht den heutigen, überdies ideologisch aufgeladenen antizipiert zu haben?

Außerdem beziehe sich der Vorgang vorerst (!) nur auf die Online-Datenbank und die Recherche darin. „Da haben wir die Möglichkeit, einen sehr demokratischen Zugriff [sic!] zu erlauben. Wenn man von außen kommt, kann man wählen, welche Titel man sich anzeigen lassen möchte“, so Ackermann im DLF. Wer sich für das Anzeigen des historischen Titels entscheide, werde Beschreibungen sehen, die rassistisch oder diskriminierend sind, heißt es dort warnend, und dass sich die Sammlungen von diesem Sprachgebrauch distanzierten. Bei extremen Fällen mit diskriminierenden Begriffen seien auch andere Tabuworte mit Sternchen ersetzt worden. Wer auf die Sternchen klicke, könne sich das Originalwort dann trotzdem noch anzeigen lassen. Da gehe es um Begriffe wie „Bastard“, „Mischling“, „Viertelblut“ oder „Hottentotten“, erklärt Ackermann.
Die Tabuisierung bestimmter Wörter dürfe es in Museen nicht geben, und wenn sich Titel über die Jahre verändern, dann sollte das auch sichtbar sein, kritisiert Reinhard Spieler, Vorstand des Deutschen Museumsbunds und Direktor des Sprengel Museums in Hannover, im MDR: „Ich finde, wir sind als Museen historische Institutionen und wir wollen eigentlich sichtbar machen, dass man in anderen Kulturen und zu anderen Zeiten andere Werte vertreten hat. Das ist der Sinn von Museen.“ „Und das soll jetzt kultursensibel sein?“, empört sich Gabriele Kremmel auf TE. „Kulturbanausentum würde wohl eher passen. Da machen Leute ihre eigenen Vorurteile zum Maßstab aller Dinge und radieren die Begriffe, die sie mit ersteren verbinden, moralinsauer aus der Öffentlichkeit, peinlich berührt von ihren eigenen Assoziationen? Ich nenne es Kulturverleugnung.“
Auch der jüdische Historiker Michael Wolfssohn sieht die Umbenennungen kritisch. Der Bild-Zeitung sagte er: „Die Schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA war da in den 1960er-Jahren viel klüger: ‚Schwarze‘ war lange ein Schimpfwort. Sie drehten den Spieß um und machten daraus: ‚Schwarz ist schön‘.“ Die Staatlichen Kunstsammlungen merkten gar nicht, wie sie sich und ihre eigentlich gute Absicht zum Gespött machten. „Wie viele Meter ist diese Dame vom IS in Palmyra entfernt“, fragt gar Jörg Themlitz auf achgut. Ackermann sprach, bezogen auf solche Äußerungen, von „reißerischen Zuspitzungen“: „Es ist immer das Problem, dass die Dinge sehr komplex sind“, sagte sie dem MDR. Man habe es mit einem transparenten Prozess zu tun.
„entwurzelte Selbstdarstellerin“
Kunsthistoriker fürchten nun, dass die Umbenennungen zu erheblicher Verwirrung in den wissenschaftlichen Katalogen führen werden. Doch das ist nur die akademisch-logistische Perspektive, gesellschaftlich relevanter ist die traditionspolitische. Dresden hat es geschafft, seine Schätze durch die DDR-Zeit zu bewahren und zu halten, selbst den Abriss des Schlosses und anderer Gebäude zu verhindern und jüngst sogar quasi verschwundene Kunstwerke wie Frauenkirche und Taschenbergpalais wiederauferstehen zu lassen. Dresden hat immer wieder bewiesen, dass es Geschichtsbewusstsein hat und das Tradierte, Überlieferte zu schätzen weiß. Nie also hätte man ausgerechnet in Dresden so etwas erwarten können. Prompt richtete sich der vor allem sächsische Unmut gegen die Hessin Ackermann.
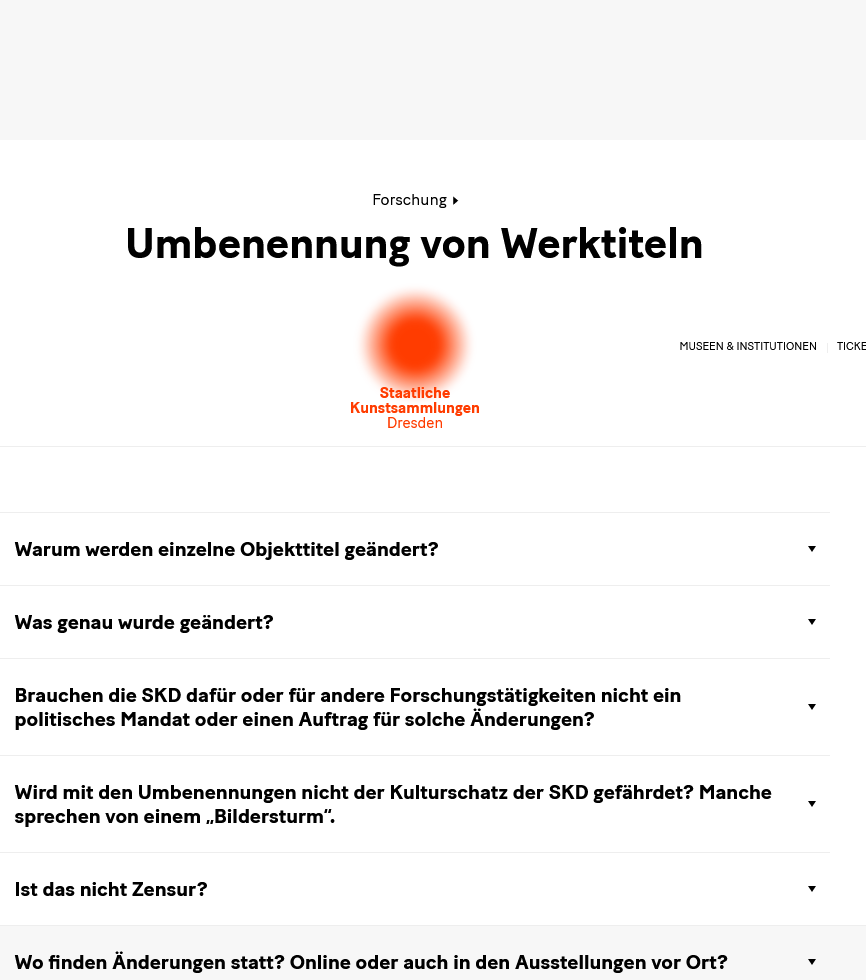
„Warum muss die ostdeutsche Kulturlandschaft dreißig Jahre nach der Wende immer noch als Entsorgungsplatz des westdeutschen akademischen Prekariats dienen?“, empört sich ein Kommentator auf TE. „Wollen wir uns wirklich fast neunhundert Jahre sächsische Geschichte von einer Dame kaputtmachen lassen, die dazu nachweislich weder einen Bezug noch Verständnis hat?“, ein anderer. Eine „entwurzelte Selbstdarstellerin“, die „nur im Jetzt lebt und keine echte Beziehung zu den Kunstschätzen und ihrem Land“ hat, „möchte nur ihren tagespolitischen Eifer dokumentieren“, erkennt ein dritter. Kopfschütteln als Dauergeste, Fremdscham als Daueremotion.
Torsten Küllig, Stadtrat der Freien Wähler Dresden, startete am 20. September eine Online-Petition, in der die Staatlichen Kunstsammlungen aufgefordert werden, „die 143 Kunstwerke wieder so zu benennen, wie sie seit Generationen schon immer heißen. Das sind wir insbesondere unseren Vorfahren, die diese Werte erschaffen und erwirtschaftet haben, schuldig.“ Diese Kunstwerke gehören den sächsischen Bürgern, argumentiert er einerseits, Ackermann sei „lediglich die Sachwalterin dieser weltweit einzigartigen Kunstschätze. Ohne sich bei den Sachsen, also den Eigentümern, für so einen weitreichenden Eingriff die Zustimmung einzuholen, fehlt der Museumsleitung schlichtweg jedwedes Mandat.“
Andererseits seien Eingriffe in die Sprachgestaltung grundsätzlich autoritären Regimen zuzuschreiben und von Demokraten klar abzulehnen: „Sprache entwickelt sich dynamisch, das ist klar, aber das funktioniert in einer freiheitlichen Gesellschaft nur von unten nach oben, niemals umgekehrt. Sobald sich Vertreter von staatlichen Einrichtungen unmittelbar oder auch mittelbar in die Sprachgestaltung einbringen, sollten wir alle sehr aufmerksam werden, denn die Manipulation der Sprache ist letztendlich auch die Manipulation des Denkens.“ Das trifft ins Schwarze: Unaufhebbare Unterschiede zwischen Menschen sollen also durch sprachliche Manipulationen aufgehoben, unkenntlich gemacht oder eingeebnet werden. Prangerte ich in meiner letzten Kolumne noch die Manipulation realer Dinge wie Straßen, Vögel oder Kekse an, sind es nun irreale Dinge, nämlich ästhetische Interpretationen visueller Wahrnehmungen.
Die britische Anthropologin Mary Douglas war in „Reinheit und Gefährdung“ (1966) der Ansicht, dass die „Vorstellung vom Trennen, Reinigen, Abgrenzen und Bestrafen von Überschreitungen vor allem die Funktion haben, eine ihrem Wesen nach ungeordnete Erfahrung zu systematisieren“. Die Trennung der Welt in Rein und Unrein schafft Ordnung in einer ungeordneten Welt. Dabei ist charakteristisch, dass die Trennung in Rein und Unrein sich auf unsichtbare Gefahren bezieht. Die Bedrohung kommt aus einer sinnlich nicht wahrnehmbaren Welt und greift über in die sichtbare Welt der Erscheinungen. „Die Parallele zu der vorherrschende Corona- und Klima-Angst ist evident“, erkannte Gérard Bökenkamp auf achgut. An die Stelle von Geistern und Dämonen treten Viren, Treibhausgase und ideologische Zuschreibungen. Wie bei archaischen Kulturen besteht die Antwort in die gesamte Gesellschaft erfassenden Reinigungsritualen, ob von Klimaskeptikern oder Coronakritikern wie von Sprachtraditionalisten oder Kunstwahrern.
„Folgt Identitätsraub auf Kunstraub?“
Ackermann gibt sich unbeirrt: „Wir müssen einen Weg finden, diese Zerrissenheit der Gesellschaft und die Vielstimmigkeit umzusetzen und Angebote zu machen für die Menschen“, sagt sie im DLF. Wie man mit Fragen der Umbenennung weiter verfahre, kann sie sich als Teil einer öffentlichen Diskussion vorstellen. „Ich habe mir überlegt, eine Art Bürgersprechstunde für unsere Forschungsabteilung einzurichten, damit die Menschen gerade nach dieser Debatte die Möglichkeit bekommen können, Einblick zu nehmen, wie hier entschieden und gearbeitet wird.“ Das ist ebenfalls kein Witz. Kein Wort darüber, die „Zerrissenheit der Gesellschaft“ zu überwinden, sie zu einen; stattdessen ihre Abbildung, gepaart mit einer Demokratiesimulation, um Partizipation, ja Einfluss vorzugaukeln.
„Folgt Identitätsraub auf Kunstraub?“ fragt sich ob solch diktatorischer Arroganz Küllig, dessen Petition nach zwei Wochen bei 3.700 Unterschriften verharrt. Und als sei ihm diese Marke Fanal, hat sich prompt der sattsam bekannte SZ-Feuilletonist Oliver Reinhard Anfang Oktober in die Debatte gemischt und Küllig der „rhetorischen Schaumschlägerei“ geziehen. Was der Nordrhein-Westfale jedoch – entweder in völliger historischer Unkenntnis oder ebenso geschichtsklitternd wie Ackermann – für eine Argumentation entfaltete, lässt einem den Atem stocken. „Wer Dinge sagt wie ‚Eingriffe in die Sprachgestaltung sind grundsätzlich autoritären Regimen zuzuschreiben und von Demokraten klar abzulehnen‘, hat offenkundig auch jegliches Angebot zur Wissenserweiterung über Rechtschreibreformen oder die Sprachwandel-Kanonisierungen der Duden-Redaktion klar abgelehnt“, ist da zu lesen.

Wer wandelt da was? Reden westdeutsche Stahlkocher oder ostdeutsche Bergleute so? Diese Anmaßung erzürnte selbst SPD-Grande Wolfgang Thierse in der SZ, weil sie „Ausdruck einer befremdlichen Angst wäre und einer geradezu bestürzenden Unterschätzung des Publikums“. Oder gar: „Doch wer sich wirklich um Sprache sorgt, geht mit ihr auch beim Äußern von Kritik verantwortungsvoll um, statt identitätstrunken den vulgärpopulistischen Phrasenhammer zu schwingen“. Wie redete doch der Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes, Hermann Kant, am 30. Mai 1979: „Wer die staatliche Lenkung und Planung auch des Verlagswesens Zensur nennt, macht sich nicht Sorgen um unsere Kulturpolitik – er will sie nicht.“ Beides ist reine Ideologie, einfach nur erschreckend und lässt uns plötzlich wieder da sein, wo wir nie wieder sein wollten.
„Nein zur Auslöschung von irritierender Erinnerung, nein zur Beseitigung von historischen Stolpersteinen, nein zur Einebnung von Differenz“, empfand das Thierse, jüngst selbst mit der Keule der Identitätspolitik gedroschen, ähnlich. „Denn aus gereinigter Geschichte ist nichts wirklich zu lernen“, weiß er und mahnt zu Behutsamkeit. Denn „wer entscheidet darüber, welche und wessen Verletzungen der Maßstab dafür sind?“ Ein Museum mag auch moralische Lehranstalt sein, es ist aber auch „ein Ort der Differenz: zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen dem Fremden und dem Eigenen, zwischen dem Alten und dem Jetzigen. Genau diese Differenz erst ermöglicht ästhetische Erfahrung und, ja, auch Urteilen und Lernen.“ Sein Appel lautet prompt: „Schüttet nicht das ästhetische Kind mit dem moralischen Bad aus! Haltet also Maß.“
Der Vorgang erscheint wie ein Mosaikstein im Wandel von der deutschen Kulturnation zu einer von den historischen Wurzeln der Deutschen losgelösten „multikulturellen Willensnation“, den der Berliner Politikwissenschaftler Martin Wagener („Kulturkampf um das Volk“, 2021) jüngst behauptete. In Politik und Medien sei eine ausgeprägte Distanzierung vom Eigenen zu beobachten: Das reiche vom Rassismusvorwurf gegen Heino, der für seine Tournee 2021 den Titel „Heino goes Klassik – Ein deutscher Liederabend“ gewählt hatte, wodurch sich Migranten ausgeschlossen fühlen könnten; bis zur Basis der Grünen, die das Wort „Deutschland“ aus dem Titel des Bundestagswahlprogramms tilgen wollte, weil es „negativ assoziiert“ werde. Parallel dazu verschwänden historische Anknüpfungspunkte durch Prozesse der „Hypokognition“, also der sprachlichen Vernachlässigung, aus dem Bewusstsein. Und diese Vernachlässigung wird durch Ideologen wie Ackermann aktiv betrieben. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu Orwell: „Um die Lügen der Gegenwart durchzusetzen, ist es notwendig, die Wahrheiten der Vergangenheit auszulöschen.“ Das klingt so erschreckend wie es ist.